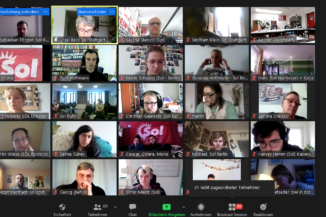Der Linke Parteitag: (noch) keine neue Partei
Der Bundesparteitag der Linken fand am vergangenen Wochenende unter gänzlich anderen Voraussetzungen statt, als die letzten beiden Parteitage – die Delegierten jedoch waren dieselben, wurden sie doch schon vor anderthalb bis zwei Jahren gewählt. Dementsprechend waren die über 50.000 neuen Mitglieder, die in den letzten Monaten in Die Linke eingetreten waren, auf der Versammlung in Chemnitz (noch) nicht repräsentiert. Es wird also spannend, ob der nächste Parteitag in Zusammensetzung und politischer Ausrichtung anders ausschauen wird.
Von Sascha Staničić, Bundessprecher der Sol und Linke-Mitglied
Am Ende wurde es dann doch noch mal spannend und kontrovers. Gegen die Empfehlung des geschäftsführenden Parteivorstands beschlossen die Delegierten einen Antrag, der sich der Jerusalemer Erklärung als Antisemitismus-Definition anschloss. Das stellt nicht nur einen Akt der Solidarität mit der Palästina-Solidaritätsbewegung dar, die von bürgerlichen Parteien und Medien mit einem Antisemitismus-Vorwurf überzogen wird, welcher sich in der Regel auf die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) bezieht. Diese stuft Kritik am Staat Israel als antisemitisch ein. Es vereinfacht ebenfalls die Organisierung palästinasolidarischer Genoss*innen in der Partei, da diese nicht mehr so leicht unter dem Vorwand des Antisemitismus und des “parteischädigendem Verhalten” ausgeschlossen werden können, wie es mit dem Genossen Ramsy Kilani geschehen ist. Das war eine doppelte Ohrfeige für den Parteivorstand, der noch am Donnerstag einen skandalösen Beschluss gefällt hatte, der genau diese Logik beinhaltete (siehe hier).
Zuvor hatte der Parteitag schon eine Resolution zur aktuellen Situation in Gaza verabschiedet, die einen Kompromiss zwischen Parteivorstand und Antragsteller*innen darstellte, aber deutlich Position gegen die Vertreibung der Palästinenser*innen aus Gaza, gegen den Krieg und die Besatzung bezieht. In diesem Sinne war der Parteitag für die Solidaritätsbewegung für die Palästinenser*innen ein Erfolg. Auch wurde ein Antrag mit dem Titel „Ohne Wenn und Aber: Sage Nein zu Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit“ beschlossen, der unter anderem noch einmal die Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine festhält.
Comeback-Feier
Abgesehen davon gab es wenig Aufregung und wenig offene Kontroverse auf dem Parteitag. Die Partei feierte ihr Comeback bei den Bundestagswahlen und die vielen zehntausend neuen Mitglieder, der Leitantrag wurde mit großer Mehrheit beschlossen und die Stimmung war entsprechend gut. Wie so oft, wurden die kontroversen Themen nicht wirklich ausdiskutiert, teilweise nicht mal klar benannt.
Ein Antrag des Jugendverbands linksjugend[‘solid] und des Studierendenverbands SDS, der die Senator*innen und Minister*innen der Linken in den Landesregierungen von Bremen und Mecklenburg-Vorpommern zum Rücktritt aufforderte, weil diese im Bundesrat der Aufhebung der Schuldenbremse zur grenzenlosen Aufrüstung zugestimmt hatten, wurde nur knapp abgelehnt und die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner musste selbst ans Mikro gehen, um die Delegierten zur Ablehnung aufzurufen. Beschlossen wurde aber eine deutliche Kritik an deren Abstimmungsverhalten: „Es war richtig, dass die Linke im Bundestag geschlossen gegen die Grundgesetzänderung und die damit verbundene Hochrüstung gestimmt hat. Dass die mit linker Beteiligung regierten Bundesländer Bremen und Mecklenburg Vorpommern für die Grundgesetzänderung votierten, war hingegen falsch und hat unserer politischen Glaubwürdigkeit geschadet. Jetzt kommt es darauf an, konkrete Schritte gegen die Militarisierung der Gesellschaft einzuleiten und aktiv zu werden: gegen Krieg und Aufrüstung und für die Perspektive einer anderen Gesellschaft, in der nicht die Interessen des Kapitals die Richtung vorgeben.“ Außerdem wurde auch beschlossen, für die Zukunft Regelungen zu finden, die verhindern sollen, dass sich so etwas wiederholt
Diese Abstimmungen drückten Unzufriedenheit unter einem großen Teil der Delegierten mit dem Vorgehen der Parteiführung in diesen Fragen auf. Diese hingegen trat mit radikalen Worten auf.
Heidi Reichinnek und Ines Schwerdtner betonten in ihren Reden zum Auftakt des Parteitags beide, dass der Kapitalismus abgeschafft werden muss. “Wenn es radikal ist, zu fordern, dass alle Menschen genug zum Leben haben, dann sind wir radikal“, „wir stellen die Eigentums- und Verteilungsfrage“, „wir stehen kompromisslos an der Seite der Arbeitenden“, „lasst uns Politik für unsere Leute machen“ und „weil sie unsere Leute verachten, verachten wir ihre Politik“ sind einige der markigen Aussagen aus den Reden der Partei- und Fraktionsvorsitzenden.
Fragen, die einer tiefer gehenden Debatte und politischer Klärung bedürften, wurden wenig angesprochen und nicht vertieft. Weder die Frage, ob Regierungsbeteiligungen mit prokapitalistischen Parteien wie SPD und Grünen angestrebt werden sollen, noch ob die Zustimmung zum Vorziehen des zweiten Wahlgangs der Kanzlerwahl richtig war, wurden ausdiskutiert. Aber dann in den Reden und Beschlüssen eben doch Pflöcke dazu eingeschlagen und vor allem in der Öffentlichkeit Positionen bezogen. So finden sich im beschlossenen Leitantrag diese Sätze, die Regierungsbeteiligungen mit prokapitalistischen Parteien faktisch unterstützen: „Dies bedeutet auch, dass unsere Parlamentarier*innen mit ihren Anfragen, ihrer thematischen Arbeit in Ausschüssen aber auch in Regierung die Interessen der Vielen vertreten.“ Und: „Dort, wo wir kommunal, auf Landes- oder Bundesebene in Parlamenten sitzen und regieren, arbeiten wir für die Verbesserung der Lebensbedingungen der breiten Mehrheit und benachteiligter Minderheiten.“ Dass genau dieser Anspruch bei den realen Regierungsbeteiligungen der Linken (und vor ihr der PDS) nicht eingehalten wurde, wird nicht benannt.
Establismentalisierung 2.0?
Während beim Parteitag auch kritische Stimmen dazu zu hören waren, dass Die Linke im Bundestag einen schnellen zweiten Wahlgang zur Kanzlerwahl in der vergangenen Woche zugestimmt hat, hat Ines Schwerdtner in Interviews zum Parteitag noch einen drauf gesetzt. Auf die Frage, welche Gegenleistungen sie dafür erwarte, antwortete sie, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD und keine wechselnden Mehrheiten im Bundestag geben dürfe. Die CDU müsse begreifen, „dass sie an uns nicht mehr vorbei kommt“ und dass ihr Unvereinbarkeitsbeschluss „aus der Zeit gefallen“ sei und es eine Zusammenarbeit der demokratischen Parteien geben müsse. Wieso sie nicht deutlich erklärt, dass sie mit der Kapitalist*innen-Partei CDU nichts gemeinsam hat und diese und ihre Politik bekämpft, kann Ausdruck der „Establishmentisierung“ (Sebastian Friedrich) der Linken sein, die vor dem „Comeback“ schon sehr weit gegangen war und durch die neue Führung der Partei scheinbar nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird. In demselben Interview betont Ines Schwerdtner, dass die Partei keine Angst vor dem Regieren habe, wie sich ja in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern zeige. Diese Haltung beinhaltet die Gefahr, dass die Fehler der Vergangenheit wiederholt und die nun geweckten großen Hoffnungen enttäuscht werden.

Organisieren
Das Motto des Parteitags lautete „Die Hoffnung organisieren“. Die Notwendigkeit, die Arbeiter*innenklasse im Betrieb, in den Nachbarschaften etc. zu organisieren, wird deutlich stärker betont als in der Vergangenheit. Das ist ein wichtiger Fortschritt und die Debatte über die Umsetzung davon, wie Die Linke zu einer sozialistischen Klassenpartei werden kann, ist die wichtigste Debatte, die in den nächsten Wochen und Monaten in der Partei geführt werden muss. Dazu werden sich Sol-Mitglieder in die Partei einbringen.
Die Sol war mit Mitgliedern aus Berlin, Chemnitz, Großpürschütz (Thüringen), Kassel und Leipzig beim Bundesparteitag. Leider war diesmal die Durchführung eines Info-Stands nicht möglich. Es wurden 50 Ausgaben der „Solidarität“ an die Delegierten verkauft und einige Interessierte für die Sol kennen gelernt.
Beschlüsse des Parteitags:
Nicht gehaltener Redebeitrag des AKL-Delegierten und Sol-Mitglieds Frank Redelberger:
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir wollen sozialistische Klassenpartei sein. So steht es im Leitantrag. Wenn wir aus diesem Anspruch alle nötigen Schlussfolgerungen ziehen, dann wird die Hoffnung, die das Wahlergebnis und die zehntausenden neuen Mitglieder ausgelöst haben, nicht auf Sand gebaut sein.
Sozialistische Klassenpartei bedeutet Partei des Klassenkampfs zu sein, bedeutet den Klassenkampf und die Selbstorganisation der Arbeiter*innenklasse in den Mittelpunkt unseres Wirkens zu stellen. Sozialistische Klassenpartei bedeutet auch, Partei des Sozialismus zu sein, also immer und überall den Kapitalismus als Ursache der Missstände anzuklagen, die Eigentums- und Machtverhältnisse in Frage zu stellen.
Sozialistische Klassenpartei sein bedeutet nicht:
– im Bundesrat der Aufhebung der Schuldenbremse zur grenzenlosen Aufrüstung zuzustimmen
– bedeutet nicht: Waffenlieferungen an eine kapitalistische und nationalistische Regierung in der Ukraine zuzustimmen
– bedeutet nicht, Haushaltskürzungen in pro-kapitalistischen Landesregierungen zuzustimmen
– und bedeutet auch nicht, einem Friedrich Merz den Weg zur Kanzlerschaft im Namen der „parlamentarischen Stabilität“ zu erleichtern
Der Aufschwung unserer Partei gibt Hoffnung. Er bedeutet aber auch Verantwortung.
Wir diskutieren viel darüber, wie wir aus der Krise raus gekommen sind, aber zu wenig darüber, wie wir in diese Existenzkrise geraten sind.
Das sollten wir aber tun, wenn wir vermeiden wollen, wieder in eine solche Situation zu geraten.
Und wer denkt, die Antwort auf die Frage sei Sahra Wagenknecht, macht es sich zu einfach. Sahra Wagenknecht hat falsche Antworten auf die Probleme der Partei gegeben und sie hat sie vergrößert, aber sie war nicht die Ursache dieser Probleme.
Wir haben immer mehr Unterstützung verloren und der AfD den Raum gegeben, Unterstützung zu gewinnen, weil uns immer mehr Menschen – nachvollziehbarerweise – immer weniger vom prokapitalistischen Establishment unterscheiden konnten.
Weil wir in Koalitionen mit SPD und Grünen den Kapitalismus verwaltet statt bekämpft haben und sich diese Regierungen kaum von anderen Regierungen unterschieden haben, weil Parlamentarismus wichtiger geworden war als Klassenkampf, weil wir immer staatstragender statt rebellischer geworden waren.
Wir haben bei den Bundestagswahlen auch so gut abgeschnitten, weil klar war: wir sind linke Opposition und nicht Regierungspartei im Wartestand!
Wenn wir weiter stärker werden wollen, dürfen wir nicht die Fehler der Vergangenheit machen, die auch schon wieder Fehler der Gegenwart sind.
Wir müssen ein paar Fragen klären:
Wir müssen eine Partei werden, die unmissverständlich gegen alle kapitalistischen Kriege und gegen alle Waffenlieferungen an kapitalistische Regierungen eintritt.
Wir müssen in allem, was wir tun die Opposition gegen die Merz-Klingbeil-Regierung sein und nicht darauf schielen, von dieser anerkannt und umworben zu werden. Ob die CDU ihren Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linken aufhebt oder nicht, kümmert uns nicht, weil sie für uns keine Bündnispartnerin ist!
Wir müssen jetzt den Kampf gegen den Klassenkampf von oben, den diese Regierung betreiben wird, organisieren. Lasst uns Gewerkschaften, Mieter*innenbewegung und andere zu einer großen Widerstandskonferenz einladen, um Massenproteste gegen die Flexibilisierung der Arbeitszeit und die anderen kommenden Angriffe zu organisieren.
Lasst uns den Sozialismus zum integralen Bestandteil unseres Programms machen, nicht zu einem abstrakten Bekenntnis – wobei er das ja im Leitantrag nicht einmal ist, da kommt der Begriff gar nicht vor.
Lasst uns sagen: wer entlässt, wird enteignet und erklären, dass die nötige ökologische Transformation der Industrie nur auf der Basis von öffentlichem Eigentum und sozialistischer Wirtschaftspolitik möglich sein wird.
Lasst uns nicht bescheiden werden, sondern deutlich machen, dass wir diejenigen sind, die nicht nur ein größeres Stück vom Kuchen wollen, sondern die die ganze Bäckerei in die Hände der Arbeiter*innenklasse geben wollen.