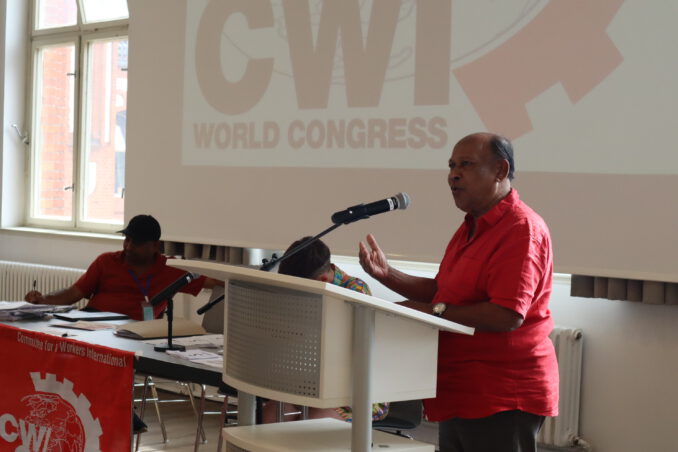
Vorlage zum 14. Weltkongress des Komitees für eine Arbeiter*inneninternationale (CWI)
Ende Juli tagte der 14. Weltkongress des Komitees für eine Arbeiterinneninternationale (CWI) in Berlin. Vertreterinnen aus über zwanzig Ländern kamen zusammen, verabschiedeten verschiedene Resolutionen und wählten neue Leitungsgremien des CWI. Wir veröffentlichen heute einen Text, der als Diskussionsgrundlage für die Debatte zur Situation in Asien diente, aber nicht abgestimmt wurde. Im September können alle Texte auch als Broschüre unter info@solidaritaet.info bestellt werden.
Einst als Wirtschaftsmotoren Asiens und Triebkräfte des globalen Wirtschaftswachstums angesehen, stoßen China und Indien nun an die Grenzen ihres export- und finanzgetriebenen Wachstums. Chinas Konjunkturabschwächung – die sich in einem Rückgang des BIP von über zehn Prozent pro Jahr in den 2000er Jahren auf unter fünf Prozent bis Mitte der 2020er Jahre zeigt – lässt einige sogar einen Rückgang auf unter vier Prozent prognostizieren. Auch Indiens rasantes Wachstum, das vom Dienstleistungssektor und Kapitalzuflüssen angetrieben wurde, hat keine breit angelegte Industrialisierung bewirkt und keine sicheren Arbeitsplätze für die große arbeitende Bevölkerung geschaffen. Über achtzig Prozent der Erwerbstätigen sind nach wie vor in der informellen Wirtschaft tätig. Das Land ist auf dem Weg zur viertgrößten Volkswirtschaft der Welt – und einige, wie JP Morgan, sagen voraus, dass es bis 2027 Deutschland und Japan überholen und zum drittgrößten Wirtschaftsraum aufsteigen wird –, doch für die große Mehrheit der Bevölkerung bleibt dies weitgehend bedeutungslos.
Mehrere andere Länder in der östlichen Region, die von Chinas exportgetriebenem Wachstum profitiert haben – wie die Philippinen, Malaysia, Vietnam und Indonesien – sehen ebenfalls einer ungewissen Zukunft entgegen.
Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für Malaysia für dieses Jahr auf 3,9 Prozent gesenkt. Infolge der COVID-19-Pandemie stieg die Staatsverschuldung Malaysias stark an und erreichte 64 Prozent des BIP. Im Jahr 2024 wurden rund 16 Prozent der gesamten Staatseinnahmen allein für den Schuldendienst aufgewendet. Enorme Kreditaufnahmen – vor allem bei China – tragen nicht zur Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität bei. Stattdessen floss ein Großteil der Schulden in groß angelegte Infrastruktur-Megaprojekte. Gleichzeitig sind auch die Schulden der privaten Haushalte stark angestiegen und erreichten 84 Prozent des BIP, da die Kosten für lebensnotwendige Güter, insbesondere Energie, weiter steigen.
Die asiatische Region hat in den letzten Jahrzehnten insgesamt mehr als die Hälfte zum weltweiten Wirtschaftswachstum beigetragen. Jede Veränderung der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder wird tiefgreifende globale Auswirkungen haben. In dieser Region leben über sechzig Prozent der Weltbevölkerung und sechzig bis 65 Prozent der globalen Mittelschicht. Obwohl die meisten Unternehmensgewinne in den letzten zehn Jahren von US-amerikanischen multinationalen Konzernen erzielt wurden, waren diese Gewinne in hohem Maße von billigen Arbeitskräften in Asien abhängig, um Waren kostengünstig herzustellen und Zugang zum mittlerweile größten Absatzmarkt der Welt zu erhalten. So sind beispielsweise sechzig Prozent der Gewinne von Apple und vierzig Prozent der Produkte von Amazon mit dieser Region verbunden.
Die jahrzehntelange Verlagerung der Produktion nach Asien hat zu einer Konzentration der weltweiten Produktion in dieser Region geführt. Rund neunzig Prozent der Halbleiter – weltweit wichtige Rohstoffe – werden in Taiwan, Südkorea und China hergestellt. Bangladesch, Indien und Vietnam dominieren die Textil- und Bekleidungsindustrie. Darüber hinaus dominieren China und andere regionale Mächte mittlerweile die Automobilindustrie, die Märkte für erneuerbare Energien und weitere Bereiche.
Während dieser Aufstieg zunächst die Gewinne vieler westlicher Unternehmen steigerte, hat er die Dominanz der USA und anderer westlicher Volkswirtschaften in Frage gestellt und zu erhöhten geopolitischen Spannungen und protektionistischen Maßnahmen geführt. Die Wahl von Donald Trump hat diese Trends noch beschleunigt. Zölle und Sanktionen haben den Druck auf viele Volkswirtschaften erhöht. Die „Entkopplung“ von China hat zwar zu dessen Konjunkturabschwächung beigetragen, aber auch innenpolitische Faktoren haben eine wichtige Rolle gespielt. Chinas Immobilienmarkt steht vor einer Krise, wobei fallende Preise, steigende Hypothekenausfälle und eine alternde Bevölkerung die Situation verschärfen.
Indien hat unterdessen seine grundlegenden wirtschaftlichen Probleme nicht überwunden: Schattenbankgeschäfte, übermäßige Kreditvergabe im Bankensektor, die Schließung kleiner Industriebetriebe, sinkende Löhne und ein Rückgang der Warenexporte. Die Arbeitslosenquote lag im Mai dieses Jahres laut offiziellen Angaben bei 5,6 Prozent, obwohl viele die Glaubwürdigkeit dieser Zahl anzweifeln. Trotz der anhaltenden Rezessionstendenzen aus der Zeit vor der Pandemie wurde das jüngste Wachstum hauptsächlich durch billiges russisches Öl und einen begrenzten Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen, insbesondere im Technologiesektor, angetrieben. Seit dem Krieg in der Ukraine ist Russland zum wichtigsten Rohöllieferanten Indiens aufgestiegen. Indien hat von der Abkehr von China nur geringfügig profitiert, aber seine schlechte Infrastruktur bleibt ein Hindernis.
Die Verschuldung ist ein weiteres kritisches Problem. Viele Volkswirtschaften, darunter auch Indien, haben ein schuldenfinanziertes Wachstum erlebt. Große Volkswirtschaften können zwar hohe Schuldenquoten bewältigen, kleinere Länder verfügen jedoch nicht über ähnliche Handlungsspielräume. Obwohl Sri Lanka das einzige Land in der Region war, das 2022 offiziell zahlungsunfähig wurde, erreichten mehrere andere Länder – Pakistan, Bangladesch, Vietnam und die Mongolei – ebenfalls Krisenpunkte. Thinktanks wie das IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) gehen davon aus, dass Indien in vielen Sektoren inzwischen an Grenzen gestoßen ist.
Steuersenkungen für die Reichen, Angriffe auf die Arbeits- und Lebensbedingungen und die Bemühungen der indischen Zentralbank, die Rupie mit Devisenreserven zu stützen, haben die Krise nicht lösen können.
Modis Initiative „Make in India” und Xi Jinpings „Made in China 2025” haben bislang nicht die erhofften Ergebnisse gebracht, auch wenn sie einige Teilerfolge erzielen konnten.
Chinas Strategie, den Fokus wieder auf den Binnenmarkt zu richten und Schlüsselbranchen zu subventionieren, hat das Unvermeidliche nur hinausgezögert. Die einzigartige Form des chinesischen Staatskapitalismus ermöglicht es der Regierung, durch Umstrukturierungen und Rettungsaktionen entschlossen in staatliche Unternehmen einzugreifen. Doch selbst mit solchen Maßnahmen führt die Überproduktion in einigen Branchen weiterhin zu deflationären Zwängen.
Die Bemühungen, diese Wirtschaftskrise auszugleichen, haben keine breite Unterstützung gefunden. So wird beispielsweise Chinas Versuch, einen Acht-Stunden-Tag durchzusetzen, von vielen Arbeiter*innen aufgrund der stagnierenden Löhne als Lohnkürzung angesehen. Diese Unzufriedenheit führte zu Streiks bei BYD, einem der größten Automobilhersteller Chinas, wo sich die Beschäftigten verschiedener Werke zu gemeinsamen Aktionen zusammenschlossen. Was weiterhin besteht, ist die „996-Arbeitsethik” (Arbeit von 9 bis 21 Uhr an sechs Tagen in der Woche). Ohne angemessene Löhne sind die meisten Arbeiter*innen in diesem Arbeitsmodell gefangen, obwohl es massiven Widerstand gibt, insbesondere unter jungen Beschäftigten. Daher fördern junge Arbeiter*innen die „Tang Ping”-Bewegung (flach liegen), um weniger zu arbeiten.
Chinas Konjunkturabschwächung wirkt sich auch auf seine regionalen Vorzeigeprojekte wie die Neue Seidenstraße und den China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) aus. Die Kreditvergabe chinesischer Banken geht zurück, und alle großen chinesischen Banken meldeten in diesem Jahr Gewinneinbußen. Als weltweit größter Kreditgeber wird China laut dem Lowy Institute im Jahr 2025 voraussichtlich 21 Milliarden US-Dollar an Rückzahlungen von Entwicklungsländern einnehmen. Die Bemühungen zur Umstrukturierung dieser Kredite könnten die geopolitischen Spannungen verschärfen, da einige Länder möglicherweise ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Dies kann zu weiteren Spannungen führen. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Ländern ist in dieser Region im Vergleich zu anderen Regionen der Welt am schwächsten. Es besteht immer die Gefahr einer Eskalation der Spannungen zwischen den Nationen. Den BRICS-Staaten, die vor allem dank China, Indien und Brasilien mittlerweile den größten Wirtschaftsblock der Welt bilden, mangelt es an Kohärenz. Sie dienen eher als Gegengewicht zum Dollar und zum westlichen Einfluss als als einheitliche Wirtschaftsunion.
Die Spannungen zwischen Indien und China sind weiterhin hoch und könnten sich verschärfen, wie der jüngste Krieg zwischen Indien und Pakistan um Kaschmir gezeigt hat, in dem China Pakistan mit militärischer Ausrüstung unterstützte, darunter Flugzeuge, die die von Frankreich gelieferten Flugzeuge Indiens übertrafen. Auch die Situation in Taiwan bleibt ein potenzieller Krisenherd, obwohl eine wachsende pro-chinesische Fraktion innerhalb Taiwans die interne Dynamik verändert. Selbst taiwanesische Rechtsradikale haben angedeutet, dass sie eine „Regelung” einem Krieg vorziehen.
Für die nächste Zukunft ist in keiner Volkswirtschaft der Region mit einer starken Konjunktur zu rechnen. Die Auswirkungen des Abschwungs in den Regionen, die bislang das globale Wachstum getragen haben, werden erst allmählich spürbar. Selbst die Weltbank geht davon aus, dass das globale Wachstum in den kommenden Jahren „so schwach ausfallen wird wie seit den 1960er Jahren nicht mehr”.
Die Krisen, mit denen die kleineren Volkswirtschaften der Region konfrontiert sind, sind beispiellos. Dramatisch gestiegene Auslandsverschuldung, schwindende Reserven und hohe Inflation sind zu gemeinsamen Merkmalen geworden. Um einen Zahlungsausfall zu vermeiden, greifen viele Volkswirtschaften zu weiteren Krediten, was die Krise nur noch verschärft.
Pakistan konnte eine Zahlungsunfähigkeit knapp vermeiden, dank eines IWF-Kredits in Höhe von rund sieben Milliarden US-Dollar sowie Investitionen aus China im Rahmen des CPEC-Projekts – Schulden, die einigen Schätzungen zufolge mittlerweile dreißig Milliarden US-Dollar übersteigen. Die vom IWF auferlegten Bedingungen haben jedoch die Lebensbedingungen von Millionen Menschen erheblich verschlechtert, was einige Kommentatoren als „wirtschaftliche Schlachtung” bezeichnen. In bestimmten Sektoren werden bis zu sechzig Prozent der Löhne besteuert. Die Preise für Grundbedarfsgüter wie Strom und Treibstoff sind so stark gestiegen, dass die ländliche Bevölkerung sie sich nicht mehr leisten kann. Der Durchschnittslohn ist auf etwa 250 US-Dollar pro Monat gesunken – unter den 350 US-Dollar in Sri Lanka –, wobei viele Arbeiter*innen weniger als siebzig US-Dollar verdienen. Während die Regierung sich zur Rückzahlung der Schulden und zur Sicherung die Gewinne der Superreichen (deren Vermögen im letzten Jahr um mindestens 15 Prozent gestiegen ist) zu sichern, leben über 120 Millionen Menschen – fast die Hälfte der Bevölkerung – unterhalb der Armutsgrenze. Das Gesundheits- und Bildungswesen hat sich aufgrund anhaltender Haushaltskürzungen verschlechtert.
Bangladesch hat Pakistan in Bezug auf das BIP überholt und die Armut etwas verringert, was vor allem auf den Textilsektor zurückzuführen ist. Diese Erfolge sind jedoch auf extreme Ausbeutung zurückzuführen. Eine Studie der Universität Nottingham berichtet, dass bis zu achtzig Prozent der Frauen und Kinder im Textilsektor unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten und die meisten weniger als hundert US- Dollar pro Monat verdienen. Schockierende hundert Prozent der befragten Minderjährigen waren illegal beschäftigt, und 32 Prozent der Erwachsenen erhielten weniger als den gesetzlichen Mindestlohn. Geopolitische Veränderungen, Zölle und Kürzungen der Entwicklungshilfe wirken sich nun auf die Textilindustrie aus und führen zu einer allgemeinen Konjunkturabschwächung und steigenden Preisen für lebenswichtige Güter. Die neue Übergangsregierung, die von den Führer*innen der Massenbewegungen unterstützt wird, hat den Interessen der Unternehmen Vorrang eingeräumt. Der Haushalt vom Juni kürzte die Ausgaben für Gesundheit und Bildung, erhöhte die Steuern auf Waren und schützte korrupte Industrien und versteckte Vermögen – im Land bekannt als „Schwarzgeldvermögen” der Reichen. Das harte Vorgehen gegen Arbeiter*innen und Arme inmitten des wirtschaftlichen Niedergangs wird die Wirtschaft nicht sanieren, sondern Armut und Verzweiflung noch verschärfen.
Die sogenannte Umschuldung Sri Lankas – lediglich eine Verzögerung der Rückzahlung – hat die Ursachen für die Zahlungsunfähigkeit nicht beseitigt. Auslandsüberweisungen und Tourismus allein können die Wirtschaft nicht wiederbeleben.
Politische Krise
Mit bis zu hundert Millionen Mitgliedern und verschiedenen Ebenen von Strukturen, Institutionen und der Zugehörigkeit einer bedeutenden Anzahl von Arbeiter*innen-, Bäuer*innen- und Jugendgruppen ist die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) eine der mächtigsten politischen Organisationen der Welt. An ihrer Spitze hat Xi Jinping eine enorme Macht konsolidiert, die nach Ansicht einiger sogar die der Mao-Ära übertrifft. Es gibt keine sichtbare Opposition, und bedeutende Dissidenten wurden bereits zum Schweigen gebracht. Diese Partei ist weder eine kommunistische Partei, wie sie es in ihren Anfängen war, noch eine sozialdemokratische Partei, sondern eher eine in den Staat integrierte Partei mit einer stark zentralisierten Kontrolle, die jedoch noch einige Elemente einer Unterstützer*innenbasis beibehält. Der Parteiapparat wird eingesetzt, um jegliche Opposition zu kontrollieren und einzuschränken. Selbst kleine Online-Chatgruppen, in denen über die Mobilisierung von Arbeiter*innen oder politische Meinungsverschiedenheiten mit dem Regime diskutiert wird, werden mit der ganzen Härte der staatlichen Überwachung und Repressionen konfrontiert. Dies spiegelt die Angst der Führung vor den Massen oder vor jeder unabhängigen Bewegung wider, die entstehen könnte. Aber keine noch so starke Unterdrückung, Kontrolle oder Verweigerung grundlegender demokratischer Rechte kann den aufkommenden Widerstand unter den Jugendlichen vollständig unterdrücken. In der neuen Generation gibt es eine starke Sehnsucht nach demokratischen Freiheiten.
Natürlich kann dieser Wunsch in prokapitalistische demokratische Bewegungen oder klassenübergreifende Proteste mit bedeutendem kapitalistischem Einfluss münden, wie es beispielsweise die Regenschirm-Bewegung in Hongkong war. Die aktuelle Konjunkturabschwächung hat jedoch auch zu einer Zunahme von Arbeiter*innenkämpfen geführt: Wanderarbeiter*innen fordern nicht ausgezahlte Löhne, Arbeiter*innen verlangen Entschädigungen nach der Schließung kleiner Fabriken, und es werden zunehmend bessere Löhne und Arbeitsbedingungen gefordert.
Diese aufkommenden Kämpfe zeigen eine zunehmende Militanz – manchmal sogar mit Zusammenstößen mit den Behörden der KPCh und der Polizei, wie wir Anfang dieses Jahres in der Provinz Shaanxi gesehen haben. Viele gut ausgebildete junge Menschen in China haben zunehmend das Gefühl, dass sie keine wirklichen Perspektive haben, außer harte Arbeitsbedingungen zu ertragen. Auch die Arbeitslosigkeit steigt, einigen Berichten zufolge auf über 18 Prozent.
Bei einer Zeremonie im Mai dieses Jahres zu Ehren von „Vorzeigearbeiter*innen” forderte Xi Jinping junge Arbeiter*innen auf, „zu kämpfen, zu kämpfen und bis zum Ende zu kämpfen”. Er meinte damit zwar, dass sie härter arbeiten sollten, aber sie könnten sich stattdessen auch für den politischen Kampf entscheiden: für die Herausforderung des Regimes selbst.
Trotz harter Repression und strenger Kontrolle entstehen sowohl online als auch offline in ganz China zahlreiche politische Diskussionen und Gruppen. Einige lassen sogar maoistische Traditionen wieder aufleben, da viele junge Menschen die frühen Tage des Maoismus positiv sehen. Laut einem Bericht der New York Times erleben diese Ideen derzeit eine Renaissance.
Das Regime geht jedoch schnell gegen alles vor, was mit „Revolution” oder als revolutionär angesehenen marxistischen oder maoistischen Ideen in Verbindung steht. Xi, der einen Doktortitel in marxistischer Theorie hat, kennt Marx’ Zitat nur zu gut: „Alles Feste vergeht“, insbesondere wenn die Massen beginnen, in die Geschichtsbücher einzugehen. Repression allein kann die wachsende Bewegung der Arbeiter <*innenund Jugendlichen in China nicht aufhalten.
Indiens sogenannter „starker Mann“ Narendra Modi und seine rechtsgerichtete BJP erscheinen nur aufgrund des Fehlens einer echten Opposition mächtig. Obwohl er seit über elf Jahren im Amt ist und mit schwindender Unterstützung zu kämpfen hat, ist keine oppositionelle Kraft entstanden, die ihn ernsthaft herausfordern könnte. Die BJP regiert, ohne eine nationale Mehrheit zu haben, und stützt sich auf Bündnisse und ein Wahlsystem, das ihr durch Siege in wichtigen Bundesstaaten wie Uttar Pradesh unverhältnismäßig viele Sitze verschafft. Allerdings hat die BJP Wahlniederlagen erlitten, nicht nur in Chhattisgarh, wo sie seit langem unpopulär ist, sondern auch in Madhya Pradesh, Rajasthan, der Delhi-Versammlung (2023) und Maharashtra (2024).
Eine Kombination aus der Stabilität der Mittelschicht, triumphalistischer Propaganda und nationalistischer Rhetorik (z. B. das Ziel, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt zu werden, oder der Krieg mit Pakistan) hat der BJP geholfen, ihre Unterstützung aufrechtzuerhalten.
Allerdings stößt Modis zunehmend autoritäres Regime, dessen Kern die rechtsextreme RSS bildet, auf wachsenden Widerstand. Von Assam über Kaschmir bis Tamil Nadu wächst die nationalistische Opposition gegen die Zentralregierung. Während vielen Arbeiter*innen und Bäuer*innen Geduld und das Abwarten auf wirtschaftliche „Trickle-down”-Effekte geraten wird, sind in Wirklichkeit die meisten Gewinne an die Superreichen und eine wachsende Mittelschicht geflossen. Propaganda, Medienkontrolle und Datenmanipulation verschleiern das wahre Ausmaß der Armut. Die Behauptung der Weltbank, dass die extreme Armut in in Indien auf 5,3 Prozent gesunken sei, wird von anderen Agenturen angezweifelt, die argumentieren, dass die Armutsgrenze von drei US-Dollar pro Tag angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten unzutreffend sei. Untersuchungen von Institutionen wie dem Great Lakes Institute legen nahe, dass 83 Prozent der indischen Bevölkerung bei Kaufkraftbereinigung von etwa zwei US-Dollar pro Tag leben.
Die sich abkühlende Weltwirtschaft, anhaltende geopolitische Spannungen und steigende Zölle werden die Not der schwächsten Bevölkerungsgruppen Indiens nur noch verschärfen. Die wachsende Wut könnte explodieren. Wir haben in der Vergangenheit bereits große Bäuer*innenproteste erlebt, und ähnliche Aufstände könnten sich wiederholen. Massenbewegungen wie in Sri Lanka und Bangladesch könnten auch in Indien entstehen.
Doch die Erfahrungen mit diesen Massenbewegungen – und ihren Grenzen – prägen auch das Bewusstsein der Bevölkerung. In Sri Lanka gelang es der Aragalaya-Bewegung, die Rajapaksa-Familie von der Macht zu vertreiben. Allerdings konnte sie keine dauerhaften demokratischen Rechte sichern. In Bangladesch wurde die Absetzung des Hasina-Regimes von einigen liberalen und rechten Gruppen als vollständiger Sieg gefeiert, doch die tief verwurzelten Probleme blieben bestehen.
In jeder dieser Bewegungen standen mutige Jugendliche und Arbeiter*innen an der Spitze, nur um dann davon überzeugt zu werden, dass Oppositionspolitiker*innen Gerechtigkeit und Demokratie bringen würden. Das Versäumnis der Demonstrant*innen in Sri Lanka, dauerhafte Organisationen zu bilden, die in den Gemeinden, Gewerkschaften und Arbeiter*innenorganisationen verwurzelt sind, ermöglichte es bürgerlichen Oppositionskräften und Populisten, das Vakuum zu füllen. Sollten solche Organisationen entstehen, selbst wenn sie klassenübergreifende Elemente enthalten, kann der revolutionäre Teil innerhalb dieser Organisationen kämpfen, um Massenunterstützung für ein weitreichendes Programm zu gewinnen. Die rechte UNP führte unter dem Deckmantel einer „Übergangsregierung“ harte Gesetze ein, inhaftierte Demonstrant*innen und arbeitete daran, die Bewegung vollständig zu zerschlagen.
Die populistische NPP unter Führung der JVP kam auf dieser Welle der Wut an die Macht. Bislang hat sie es jedoch abgelehnt, sinnvolle Maßnahmen gegen die Korruption oder die Rajapaksa-Familie zu ergreifen, und viele der kapitalistischen Politiken fortgesetzt. Sogar der IWF lobte den Haushalt der neuen Regierung, und Modis Regierung begrüßte ihn mit offenen Armen. Die chinesische Regierung sicherte ihre Interessen unter dem Banner der „Schuldenrestrukturierung“. Im Wesentlichen liefert die NPP den Kapitalisten und ausländischen Mächten mehr als die vorherigen Regierungen.
Die Schuldenlast wird, wenn auch verzögert, letztendlich auf die Arbeiter*innenklasse abgewälzt werden. Mit dem Schwinden der Popularität der von der JVP geführten NPP wächst die Militanz unter radikalen Jugendlichen. Die JVP greift nun zu autoritären Mitteln: Sie beruft sich auf drakonische Anti-Terror-Gesetze, droht mit dem Verbot von Gewerkschaften und erklärt, dass Streiks nicht mehr notwendig seien. Die Unterstützung durch Minderheiten – Tamil*innen, Muslimen/Muslimas und den Bewohner*innen der Bergregionen – schwindet rapide. Aber angesichts ihrer Rolle in Aragalaya widersetzen sich viele Jugendliche nun dem ethnischen Chauvinismus. Es wird für die derzeitige Regierung nicht leicht sein, die Angriffe auf Minderheiten zu nutzen, um ihre Macht zu festigen. Diese Maßnahmen könnten die NPP spalten.
In Bangladesch plant auch die bürgerliche BNP (Bangladesh Nationalist Party) ihr Comeback. Die sogenannte National Youth Party (NCP), die Jugendliche und Arbeiter*innen aus der Bewegung vereinen sollte, hat sich nicht durchsetzen können. Die Gründung einer politischen Partei allein reicht nicht aus; ein klares Programm und eine Organisationsstruktur, die in den Kämpfen der Arbeiter*innen verwurzelt sind, sind unerlässlich.
Sowohl in Sri Lanka als auch in Bangladesch werden „Übergangsperioden” genutzt, um die Massen zu beruhigen und zumindest einem Teil der alten herrschenden Elite Raum zu geben, die Kontrolle zurückzugewinnen. In Bangladesch hofften von den Aufständen in Sri Lanka inspirierte Jugendliche, dass die Übergangsregierung weiter gehen würde. Die Yunus-Regierung bleibt jedoch trotz einiger Gesten den kapitalistischen Interessen treu. Die Wahlen werden weiterhin verschoben, und die sogenannten Reformen haben eher zur Stärkung der Eliten als zur Stärkung der Arbeiter*innen und Bäuer*innen beigetragen. Der jüngste Haushalt greift Arbeiter*innenrechte an, kürzt die öffentlichen Dienstleistungen und bereichert die korrupte herrschende Klasse weiter. In diesem Vakuum, in dem die ehemalige Regierungspartei Awami League (AL) verboten ist, versucht die bürgerliche Bangladesh Nationalist Party (BNP) ein Comeback und dürfte bei einer Neuwahl wahrscheinlich gewinnen. In Sri Lanka strebt Namal Rajapaksa, der „Prinz” der Rajapaksa-Familie, die Rückkehr an die Macht an. In Indonesien musste die Familie Suharto nicht lange auf ein Comeback warten. Der derzeitige Präsident Prabowo Subianto, ein ehemaliger General und Suhartos ehemaliger Schwiegersohn, hat begonnen, den Einfluss des Militärs in der Gesellschaft wiederzubeleben. In diesem Jahr hat er ein Gesetz eingeführt, das Militärangehörigen die Übernahme ziviler Regierungsämter erlaubt, und der Anteil des Militärs in der Regierung hat bereits deutlich zugenommen.
Diese zunehmende Militarisierung geht einher mit einer wachsenden Welle von Studierendenprotesten, Jugendmobilisierungen und Arbeiter*innenstreiks. Anfang des Jahres organisierten alle indonesischen Studierendenvereinigungen landesweite Proteste. Die Proteste richteten sich gegen Kürzungen im Bildungbereich und im öffentlichen Dienst sowie gegen die zunehmende Kontrolle durch das Militär. In weiten Teilen der Bevölkerung breitet sich die reale Angst aus, dass das Land in den Autoritarismus der Suharto-Ära zurückfällt.
Allerdings formiert sich auch Widerstand. Neue Organisationen entstehen, und Diskussionen über Kampfmethoden und politische Alternativen gewinnen an Dynamik. Während wir demokratische Rechte verteidigen und uns gegen Militarisierung wehren, müssen wir dafür sorgen, dass die rechtspopulistischen Kräfte sich nicht einfach umbenennen und wieder an die Macht zurückkehren. Stattdessen müssen wir dafür kämpfen, diesen Kreislauf ein für alle Mal zu durchbrechen – für die Massen. Das bedeutet, Kräfte aufzubauen, die dafür kämpfen können, Unterstützung für ein sozialistisches Programm zu gewinnen, das auf die vollständige Abschaffung des kapitalistischen Systems abzielt.
In Malaysia hat die sogenannte „Einheitsregierung” von Anwar Ibrahim ihre Macht durch Reformversprechen wie die Einführung eines Mindestlohns, den Ausbau des Arbeitsschutzes und die Verbesserung der Regierungsführung gesichert. Viele dieser Versprechen wurden jedoch verzögert oder in verschiedenen Parlamentsausschüssen blockiert. Da sich die Lebensbedingungen weiter verschlechtern – insbesondere unter der malaysischen Jugend – nutzen die islamistische Partei PAS und die von Bersatu angeführte Koalition Perikatan Nasional die Gelegenheit, um Unterstützung zu gewinnen. Sie positionieren sich als Verteidiger der malaysisch-muslimischen Identität und nutzen die wachsende Unzufriedenheit und die wirtschaftliche Notlage aus.
Wie geht es weiter?
Die militanten Teile, die die Massenbewegungen anführten, sind in vielen Ländern nun an den Rand gedrängt worden, während liberale und sogar rechte Fraktionen der Bewegung, die den Status quo nie wirklich in Frage gestellt haben, gefördert und in die Regierungsstrukturen integriert wurden. In jedem Land, in dem Massenaktionen stattfanden, planen die etablierten Parteien, die militärischen Eliten oder autoritäre Regime entweder ein Comeback oder sie verfestigen repressive Maßnahmen, um künftige Aufstände zu verhindern.
Panikmache – die suggeriert, dass weitere Unruhen zu Blutvergießen und einer Konterrevolution führen werden – wird nicht ausreichen, um die wachsende Wut einzudämmen. Von den städtischen Slums Indiens bis zu den verarmten Vororten Bangladeschs breiten sich Hunger und Verzweiflung aus, was die Wut weiter anheizt. Die Versprechen von Wachstum und Wohlstand haben sich für die große Mehrheit nicht erfüllt. Auch die Hoffnungen auf eine saubere Regierungsführung und Demokratie haben sich nicht erfüllt. Wie wir in Myanmar gesehen haben, führte eine verzweifelte Lage zu einem Massenaufstand, und die brutale Unterdrückung dieser Bewegung führte schließlich zu bewaffnetem Widerstand gegen die Junta. Eine neue Generation von Jugendlichen, die einst naiv das Symbol des Hollywoodfilms „Hunger Games“ während der Proteste als Friedenssymbol hochhielten und erklärten: „Ihr habt euch mit der falschen Generation angelegt“, wurde gezwungen, zu den Waffen zu greifen, um gegen die Junta zu kämpfen.
Die Energie und Entschlossenheit der Jugendlichen, die sich zum Widerstand erhoben haben, ist unbestreitbar. Aber ihnen fehlt die mächtigste Waffe: ein klares sozialistisches Programm. Ein solches Programm ist unerlässlich, um die städtischen Arbeiter*innen und Jugendlichen mit den ethnisch gespaltenen Bevölkerungsgruppen in den ländlichen Gebieten zu vereinen. Es muss sich entschieden für volle demokratische Rechte einsetzen, einschließlich der nationalen und kulturellen Rechte aller unterdrückten Gemeinschaften, und darauf abzielen, die Ressourcen des Landes zum Wohle aller zu organisieren.
Dies bedeutet zwangsläufig, die Kapitalist*innenklasse und ihre Vertreter*innen herauszufordern und für eine sozialistische Planwirtschaft zu kämpfen, die die Grundlage für ein transformiertes Myanmar legen kann. Ohne ein solches Programm – und eine Massenorganisation, die es vorantreiben kann – läuft Myanmar Gefahr, in einer langwierigen Tragödie gefangen zu bleiben.
Obwohl die Junta erheblich geschwächt ist, hält sie sich durch Massenmorde und die militärische Unterstützung, die sie nach wie vor von China erhält, an der Macht. Die Wirtschaft liegt in Trümmern, was vor allem auf die anhaltenden Militäraktionen zur Niederschlagung jeglicher Opposition zurückzuführen ist.
Die Opposition ist zwar weit verbreitet und entschlossen, bleibt jedoch zersplittert. Dem zivilen Widerstand mangelt es an einer einheitlichen Führung und einer kohärenten nationalen Strategie, was es schwierig macht, das Regime entscheidend herauszufordern. Bewaffnete Organisationen spielen eine entscheidende Rolle im Widerstand, sind jedoch entlang ethnischer Linien gespalten und nicht in der Lage, sich vollständig mit der pro-demokratischen Bewegung in den Städten zu verbinden. Die ungelöste nationale Frage, insbesondere die Forderungen verschiedener ethnischer Minderheiten nach Autonomie, wird von der städtischen Mittelschichtjugend, die noch stark vom buddhistischen Chauvinismus der Vergangenheit geprägt ist, nicht thematisiert. Selbst im Falle eines Zusammenbruchs der Junta würden diese Spaltungen wieder zum Vorschein kommen und könnten zu einem langwierigen Bürgerkrieg führen. Die NUJ (Nationale Einheitsregierung), der auch die Nationale Liga für Demokratie (NLD), die Partei von Aung San Suu Ky, angehört, ist völlig unfähig, die nationalen Probleme verschiedener ethnischer Gruppen oder religiöser Minderheiten anzugehen.
Die Krise in Myanmar hat sich somit zunehmend verschärft, wobei anhaltende Instabilität, Unterdrückung und wirtschaftlicher Zusammenbruch noch mehr Elend über die Bevölkerung bringen.
Obwohl sich noch keine klare Oppositionskraft herausgebildet hat, ist dies nur eine Frage der Zeit. Mainstream-Linksparteien wie die CPI und CPIM in Indien oder die JVP in Sri Lanka verwandeln sich in blasse Imitationen der sozialdemokratischen Parteien der Vergangenheit. Sie sind nicht einmal bereit, so weit zu gehen wie die liberalen Kräfte, wenn es um die Gewährleistung grundlegender demokratischer Rechte geht. Zwar können symbolische Generalstreiks eine nominelle Präsenz in den Arbeitskämpfen aufrechterhalten, doch bieten diese Parteien keine Strategie oder einen Weg nach vorne. Dies hat das Misstrauen der Jugend gegenüber traditionellen Parteistrukturen weiter vertieft.
Den Arbeiter*innn und Armen in der Region wird kein klarer Ausweg geboten. Die Illusion, dass das Wirtschaftswachstum letztendlich ihren Lebensstandard verbessern würde, schwindet. Der vielbeschworene Aufstieg der asiatischen Mittelschicht (die bis 2030 schätzungsweise 3,5 Milliarden Menschen umfassen wird) zeichnete ein vorübergehendes Bild des Fortschritts auf der Grundlage kapitalistischer Expansion. Doch nun schreibt die Bloomberg-Kolumnistin Karishma Vaswani, „der asiatische Traum erwacht zur Realität“. Anhand von Daten zeigt sie, dass „Mittelschichtfamilien gezwungen sind, ihre finanziellen Prioritäten zu überdenken … Das Wachstum verlangsamt sich, die Löhne in den Städten – insbesondere in den größten Städten – sinken und die Ausgaben gehen zurück“. Viele Angehörige dieser Mittelschicht, die einst eine harte kapitalistische Politik unterstützt haben, weil sie selbst davon profitierten, werden nun verdrängt. Sie schließen sich zunehmend Protesten an und fordern demokratische Rechte und Transparenz.
Asien beherbergt laut der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 68 Prozent der weltweit erwerbstätigen Bevölkerung (85 Prozent leben im globalen Süden), wobei die höchste Konzentration in China und Indien zu finden ist. Mega-Fabriken und Industriezentren haben eine massive Konzentration von Arbeiter*innen hervorgebracht und die größte industrielle Arbeiter*innenklasse der Geschichte geschaffen. In der gesamten Region organisieren sich Arbeiter*innen für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Die Regierungen reagieren jedoch mit brutalen Repressionen, Lohnkontrollen und der Unterdrückung von Streiks. Zwar konnten durch die jüngsten Proteste einige Lohnerhöhungen durchgesetzt werden, doch wurden diese Gewinne durch Inflation und steigende Steuern größtenteils zunichte gemacht.
Ein Beispiel für die wachsende Militanz der Arbeiter*innen findet sich in Südkorea. Einst ein Vorzeigeland für Erfolg und Wohlstand, hat Südkorea heute mit wachsender Ungleichheit, sinkendem Lebensstandard, stagnierenden Löhnen und zunehmender Armut zu kämpfen. Das Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr voraussichtlich unter ein Prozent fallen, da die Exporte sowohl in die Vereinigten Staaten als auch nach China stark zurückgehen. Versuche der Unternehmer*innen, Löhne und Arbeitsbedingungen einzuschränken – in Verbindung mit den Bemühungen der Regierung, arbeiter*innenfeindliche Gesetze einzuführen – stießen auf heftigen Widerstand der Arbeiter*innen. In einer historischen Premiere traten die Beschäftigten von Samsung Electronics 2024 in den Streik, der mit einem eintägigen Protest begann und zu einer unbefristeten Arbeitsniederlegung eskalierte. Der Streik zwang die Unternehmensleitung schließlich zu Zugeständnissen bei den Löhnen und Arbeitsbedingungen. Nicht nur in Südkorea, auch in Indien und anderen Ländern schlossen sich Samsung-Beschäftigte der Mobilisierung an. Darüber hinaus traten Tausende von Ärzt*innen, Busfahrer*innen und über 60.000 Metallarbeiter*innen in den Streik, um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. Ein Schwerpunkt der Arbeitskampfmaßnahmen war der „Yellow Envelope Bill”, der, wenn auch in begrenztem Umfang, darauf abzielt, Leiharbeiter*innen zu schützen und ihr Recht auf Tarifverhandlungen zu garantieren. Der Gesetzentwurf stößt jedoch auf heftigen Widerstand von Großunternehmen und ihren Verbündeten in der Regierung. Die Koreanische Gewerkschaftsvereinigung (KCTU), die über 1,2 Mitglieder zählt, hat koordinierte Streikmaßnahmen ergriffen und ruft nun zu einem Generalstreik auf, um die Regierung zur Umsetzung des Gesetzesentwurfs zu zwingen.
Der Klassenkampf verschärft sich. Angesichts einer kapitalistischen Weltwirtschaft in Aufruhr und eines sich verschärfenden Wettbewerbs zwischen rivalisierenden Nationen und Kapitalist*innen sind neoliberale Sparmaßnahmen die einzige Antwort, die angeboten wird. Wie bangladeschische Demonstranten kürzlich sagten: „Unsere Gürtel sind bereits gerissen.“ Auch mittelständische Unternehmer*innen und Kleinunternehmer*innen werden in die Knie gezwungen, da die Mittelschicht gezwungen ist, den Gürtel enger zu schnallen, wie Forscher*innen in Bangladesch feststellen. Die große Zahl der Binnenmigrant*innen in Indien und China, die auf der Suche nach Arbeit von Region zu Region gezogen sind, hat nicht einmal einen Gürtel, den sie enger schnallen könnte.
Das Scheitern der jüngsten klassenübergreifenden Massenbewegungen, ihre Forderungen vollständig durchzusetzen, hat Rückschläge und Verwirrung verursacht. Aber die kollektiven Erfahrungen, die während der Massenprotestbewegungen gesammelt wurden, sind nicht verloren. Die Menschen haben nun verstanden, dass Massenaktionen mächtige Regime erschüttern können. Eine neue Generation gewinnt politisches Bewusstsein, sieht sich jedoch nun mit verstärkter Repression, komplexen geopolitischen Realitäten und der Gefahr eines Krieges konfrontiert.
Die Idee einer Demokratie nach westlichem Vorbild ist nach wie vor weit verbreitet. Korruption, Skandale und autoritäre Kontrolle sind die Erfahrungen der Massen in vielen asiatischen Ländern, was den Wunsch nach saubereren, demokratischeren Alternativen verstärkt. Dies war der Kern vieler Protestbewegungen: der Wunsch, die Politik zu „säubern”, indem korrupte Eliten durch „gute Leute” ersetzt werden. Diese Illusion wird jedoch oft von Vertreter*innen des Kapitalismus genutzt, um das System zu erhalten, als ob ein Wechsel der Gesichter an der Macht die zugrunde liegende Fäulnis beseitigen würde. Für Sozialist*innen sind demokratische Forderungen und die Beseitigung von Korruption, Plünderung usw. wichtige Themen, aber ihre vollständigen Slogans müssen mit der Abschaffung des verrotteten kapitalistischen Systems verbunden sein.
Es gibt auch die oft berechtigte Angst vor internationalen Vergeltungsmaßnahmen, wenn mutige wirtschaftliche Schritte unternommen werden. In Sri Lanka beispielsweise wurden Forderungen nach einem Schuldenerlass als „utopisch“ abgetan, weil man Vergeltungsmaßnahmen seitens globaler und regionaler Mächte befürchtete. Darüber hinaus mangelt es allgemein an Erfahrung darin, Streiks und die Macht der Arbeiter*innen als Mittel zur Stärkung und Führung von Bewegungen einzusetzen.
Die sich wandelnde Weltordnung legt die strukturellen Schwächen und Grenzen des Kapitalismus offen, nicht nur in Asien, sondern weltweit. Es wird immer deutlicher, dass dieses System weder die Grundbedürfnisse der Mehrheit befriedigen noch seine eigenen Versprechen einer demokratischen Regierungsführung einhalten kann.
Was sich abzeichnet, ist nicht nur eine Wirtschaftskrise, sondern eine tiefere Legitimitätskrise: eine Krise der Frage, wem das System dient. Wenn die Massen in Asien – Arbeiter*innen, Jugendliche und Bäuer*innen – ihr Schicksal ändern wollen, wird dies nicht durch das Warten auf einen „Trickle-down-Effekt” oder die Versprechen populistischer Führer*innen geschehen. Es erfordert Massenorganisation, ein klares sozialistisches Aktionsprogramm und den Mut, für eine grundlegend andere Zukunft in Asien und auf der ganzen Welt zu kämpfen.




