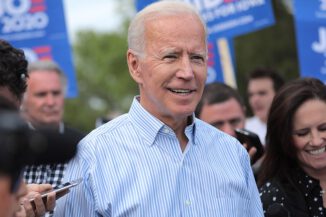Lässt man die Theatralik und die phantastischen Übertreibungen beiseite, die inzwischen untrennbar mit der Präsidentschaft Trumps verbunden sind, so läuft der am 2. April begonnene Zollkrieg im Wesentlichen auf den Versuch hinaus, dem US-Kapitalismus einen größeren Anteil an der Wertschöpfung der Weltwirtschaft auf Kosten seiner „Handelspartner“, „Freund und Feind gleichermaßen“, wie Trump es selbst ausdrückt, zuzuschanzen.
Durch die Einfuhrzölle, eine Steuer auf eingehende Waren, die von der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde im Namen der Bundesregierung an 330 Luft-, See- und Landhäfen erhoben wird, wird kein neuer Wert geschaffen. Stattdessen würden selbst bei den durchschnittlichen Zollsätzen, die derzeit gelten, nachdem Trump am 9. April angesichts des Zusammenbruchs der US-Anleihemärkte in Panik eine „Pause“ eingelegt hat, bis 2034 zusätzliche 3,4 Billionen Dollar auf den amerikanischen Staat zukommen.
Das ist zwar immer noch „nur“ ein kleiner Bruchteil des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP), der Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen – weniger als ein halbes Prozent -, aber das Wesentliche ist, was die Zollkriegserklärung bedeutet. Nachdem die USA nach dem Zusammenbruch der stalinistischen Regime in Russland und Osteuropa 1989-1991 die einzige Hegemonialmacht der Welt waren und die Institutionen der internationalen Beziehungen unter dem Banner der „Globalisierung“ in ihrem Sinne gestalten konnten, sind sie nun der große Störenfried. Nicht als Ergebnis zunehmender Stärke, sondern als krampfhafte Reaktion auf ihre schwindende Position in einer neuen, multipolaren Welt.
Das in den 1990er Jahren eingeführte US-Imperium – die triumphalistische „Neue Weltordnung“ von Präsident George HW Bush – hat mehr als dreißig Jahre später die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es sich in sein Gegenteil verkehrt. Entfesselt durchstreiften die multinationalen US-Konzerne den Globus auf der Suche nach den vorteilhaftesten Vereinbarungen, verlagerten die Produktion ins Ausland und behielten gleichzeitig den Großteil der enormen Gewinne, die sie durch Monopole für geistiges Eigentum und Technologielizenzen, Marketing usw. erzielten – und buchten bis 2022 fast zwei Drittel der ausländischen Gewinne in Steueroasen, doppelt so viel wie im Jahr 2000. Die „Silizium-Sechs“ – Amazon, Meta, Alphabet, Netflix, Apple und Microsoft – zum Beispiel, die im vergangenen Jahrzehnt 11 Billionen Dollar Umsatz erwirtschafteten, zahlten im Durchschnitt 16,1 Prozent Körperschaftssteuern, verglichen mit einem US-Inlandsdurchschnitt von 29,7 Prozent.
In der Zwischenzeit ging die Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe in den USA zwischen 1997 und 2024 um fünf Millionen zurück (einer der stärksten Rückgänge in der Geschichte überhaupt), während China seine Vormachtstellung in 42 Prozent der 120 weltweiten Sektoren des verarbeitenden Gewerbes im Jahr 2005 auf 67 Prozent im Jahr 2019 erhöhte. Der Logik des Systems folgend, Gewinne vor allem anderen zu maximieren, trug das US-Kapital tatsächlich dazu bei, seine Rivalen aufzubauen und sich selbst zu untergraben.
Das Ergebnis ist die heutige Diskrepanz zwischen der noch immer vorherrschenden Stellung der USA bei den Militärausgaben und im Weltfinanzsystem – durch die internationale Rolle des Dollars – und ihrer rückläufigen Position im Welthandel, wobei ihr Anteil an der Endnachfrage nach Importen von 22 Prozent im Jahr 2000 auf nur noch 15 Prozent im Jahr 2020 fallen wird. Nun strebt der US-Staat nach den Worten des Hedgefonds-Milliardärs und Finanzministers Scott Bessent eine „globale wirtschaftliche Neuordnung“ an. Nicht um seine Privilegien als nach wie vor mächtigste Weltmacht abzubauen, sondern um sie mit neuen Tributen zu bezahlen.
Die Tatsache, dass die Zollkriege einige der reichsten US-Unternehmen sowie Exportländer treffen werden – siehe Elon Musks öffentliche Tirade gegen Trumps „Zollguru“ und Handelsberater Peter Navarro, auf die in der Global Warning-Kolumne dieses Monats auf Seite 10 (in der entsprechenden Printausgabe von Socialism Today, Anm. d. Übers.) verwiesen wird – ist für die Arbeiter*innenbewegung in den USA und international kein Trost. Wann immer es im Kapitalismus zu einer Neuausrichtung der Werte kommt – sei es durch einen wirtschaftlichen Abschwung, neue Handelsabkommen oder die widersprüchliche Neuverteilung des Kapitals auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft – die einzige Konstante ist und bleibt der Versuch der Kapitalist*innen, dies auf Kosten der Arbeiter*innenklasse zu erreichen.
Mit dem Aufkommen der poststalinistischen neuen Weltordnung sanken die Stundenlöhne der männlichen US-Beschäftigten, so dass sie heute real niedriger sind als im Jahr 1975. In den fortgeschrittenen kapitalistischen OECD-Ländern ist der Anteil der Beschäftigten am BIP nicht wieder auf den Stand von 52 Prozent im Jahr 2000 zurückgekehrt (außer im Jahr 2020, als der Covid die Wirtschaftstätigkeit einbrechen ließ, die Löhne aber teilweise durch Freistellungen usw. gestützt wurden). Die Arbeiter*innenbewegung muss sich auf den Kampf in der neuen Ära der Zölle und einer multipolaren Zersplitterung des Welthandels vorbereiten, mit ihrer eigenen unabhängigen, internationalistischen Klassenposition.
Wen schützt der Protektionismus?
Die sozialistische und Gewerkschaftsbewegung hat seit ihren Anfängen den „freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital“ – oder von Arbeitskräften – nie prinzipiell unterstützt, sondern ist immer für ein größtmögliches Maß an Arbeiter*innenkontrolle eingetreten, deren höchste Form eine demokratische sozialistische Gesellschaft mit einer Planwirtschaft wäre. Aus diesem Grund haben die Gewerkschaften zum Beispiel historisch für den „closed shop“ gekämpft, bei dem nur Gewerkschaftsmitglieder in einem bestimmten Betrieb beschäftigt werden können, eine sehr konkrete Form der „Grenzkontrolle“, die von den Kapitalist*innen nicht unterstützt wird.
Die erste Arbeiter*innenregierung, die dauerhafte Wirtschaftsbeziehungen mit anderen Mächten einging, die im Oktober 1917 gebildete Sowjetregierung, tat dies auf der Grundlage eines staatlichen Außenhandelsmonopols, eines „Arbeiter*innenprotektionismus“ (die kurzlebige Pariser Kommune von 1871 erreichte nie die Position, die die Bolschewiki 1917 und danach einnahmen). Obwohl der frühe Sowjetstaat durch die Feindseligkeit der kapitalistischen Regierungen, die ihm gegenüberstanden, eingeschränkt war, nahm er am Weltmarkt teil – unter anderem in den 1920er Jahren durch die Beteiligung amerikanischer Berater und Ingenieure am Dneprostroi-Wasserkraftwerksprojekt, das zum drittgrößten Kraftwerk der Welt wurde, wobei der erste Generator von General Electric geliefert wurde. Dies geschah jedoch im Rahmen eines Wirtschaftsplans, der das staatliche Handelsmonopol einschloss und die Interessen der Arbeiter*innen in Russland und auf internationaler Ebene verteidigte.
Häufig entstanden Handelsbeziehungen durch den Austausch von Arbeiter*innendelegationen. Ein Beispiel war ein Programm zur Finanzierung von Bekleidungsfabriken in Russland durch die Internationale Textilarbeiter*innengewerkschaft der USA. Später, 1930, als sich die Weltwirtschaftskrise in Europa und Amerika ausbreitete und die Arbeitslosigkeit in die Höhe schoss, erhob Leo Trotzki, der gemeinsam mit Lenin die Oktoberrevolution angeführt hatte, aber inzwischen ins türkische Exil gezwungen worden war, die Forderung nach Handelskrediten für westliche Produktionsimporte – mit der Aussicht auf Arbeitsplätze für Arbeitslose -, die in den ersten Fünfjahresplan integriert werden sollten, im Gegenzug für die dadurch ermöglichte Steigerung der russischen Landwirtschaft und Rohstoffproduktion. Solche Wirtschaftsabkommen, so schlug er vor, sollten von „interessierten Arbeiter*innenorganisationen (Gewerkschaften, Betriebsräte usw.)“ überwacht werden, um sicherzustellen, dass die Interessen der Arbeiter*innen auf allen Seiten gewahrt werden; ein weiterer Grund, warum die Forderungen von der stalinistischen Bürokratie abgelehnt wurden, die keine Kontrolle ihrer Herrschaft dulden konnte und die zudem ihre Macht unter der „Theorie“ des „Sozialismus in einem Land“ gefestigt hatte.
Sicherlich ist es unwahrscheinlich, dass eine „Delegation interessierter Arbeiter*innen“ empfohlen hätte, Zölle gegen die Pinguine der Heard- und McDonald-Inseln zu erheben, wie Trump am 2. April ankündigte! Aber die Trump-Administration setzt natürlich nicht Protektionismus im Interesse und unter der Kontrolle der Beschäftigten, sondern kapitalistischen Protektionismus um.
Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass Trumps Zölle immer noch die freie Ausübung des Privateigentums an den Mitteln zur Herstellung der von uns konsumierten Waren und Dienstleistungen zulassen – daran, was und wo produziert wird, welche Preise und Löhne festgelegt werden und wie das Kapital zur Erzielung von Gewinnen für seine Eigentümer eingesetzt wird – im Rahmen der allgemeinen Gesetze des kapitalistischen Wettbewerbs. Trump behauptet, dass Investitionen und Arbeitsplätze in die USA „zurückfließen“ werden, aber Zölle können immer nur die indirekteste Form der Regulierung sein.
Stattdessen hat die Preistreiberei der Kapitalist*innen bereits begonnen. Sony hat die Preise für die PlayStation 5 weltweit erhöht, auch in Ländern, für die keine Zölle gelten, um Preiswillkür zwischen verschiedenen Märkten zu verhindern und entgangene Gewinnspannen in den USA aus den weltweiten Verkäufen zu decken. Es droht sich zu wiederholen, was nach der Einführung von Zöllen auf in die USA importierte Waschmaschinen durch die erste Trump-Administration im Jahr 2018 geschah, allerdings in einem weitaus größeren Ausmaß. Die Preise inländischer Marken, die keinen Zöllen unterworfen waren, stiegen ebenso wie die Preise für Wäschetrockner – ohne jegliche Zölle! – da jeder „Mitbewerber“ die Gewinnspannen testete.
In der Tat kann selbst die direkteste Form der staatlichen Intervention, die Verstaatlichung einzelner Unternehmen oder bestimmter Wirtschaftszweige, nur ein Schritt in Richtung Sicherung der Interessen der Arbeiter*innenklasse gegenüber den Kapitalist*innen sein, wenn auch ein äußerst wichtiger Schritt, um die Produktionskapazitäten einschließlich der angesammelten Fähigkeiten und der Technik der Arbeiter*innen zu erhalten, und zwar auf der Stelle. Die Stahlarbeiter*innen von Scunthorpe hatten den richtigen Instinkt, um zu verhindern, dass Führungskräfte der Jingye-Eigentümer des British Steel-Werks unter dem Verdacht der Industriesabotage Zugang zum Gelände erhielten, während das Parlament am 12. April in Westminster tagte, um Richtlinienbefugnisse über das Unternehmen zu übernehmen. Aber es ist auch eine Tatsache, dass die Beamten des Ministeriums für Wirtschaft und Handel, die anschließend eintrafen, das Stahlwerk immer noch innerhalb der Grenzen des Kapitalismus und seiner Forderungen nach Bezahlung der Arbeiter*innen für die Krisen des Systems verwalten werden, selbst wenn das Werk vollständig von der Regierung übernommen wird.
Der Klassenkampf wird so lange weitergehen, wie der Kapitalismus existiert. Die Arbeiter*innenbewegung wird ihr Programm entwickeln müssen, und zwar zu einem Programm, das das System stürzen kann. Und sie muss die politischen Mittel entwickeln, um dies zu umzusetzen.
Lehren aus dem Corbynismus und Syriza
Ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf die kommenden Kämpfe besteht darin, aus den Erfahrungen, einschließlich der Fehler, der Bewegungen zu lernen, die sich bei der ersten Wiederbelebung der sozialistischen Grundideen im Massenmaßstab in der poststalinistischen Ära entwickelt haben. Dazu gehörten der erste Sieg von Syriza in Griechenland im Januar 2015, der Aufstieg von Corbynis in Großbritannien im selben Jahr und die anderen Parteien und Bewegungen, die entstanden, nachdem der große Finanzcrash und die anschließende Rezession von 2007-09 die Ideologie und die Institutionen, die den Kapitalismus stützen, hart getroffen hatten.
Ein entscheidender Faktor für die Niederlage sowohl von Syriza als auch Corbyns war jedoch die Art und Weise, wie sie die Frage der internationalen Verhandlungen angegangen sind, was für eine neue Ära der Handelskriege von großer Bedeutung ist. Wie Hannah Sell in ihrem Artikel mit einem Rückblick auf die Syriza-Regierung von Alexis Tsipras vor zehn Jahren erklärt, brach diese ihr anfängliches Versprechen. Sie trat den Troika-Mächten der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und des IWF nicht wirksam entgegen, als diese versuchten, der griechischen Arbeiter*innenklasse eine beispielhaft brutale Austerität aufzuzwingen. Ohne Maßnahmen wie die Verstaatlichung der Banken, Kapitalverkehrskontrollen und ein staatliches Außenhandelsmonopol, unterstützt durch eine Massenmobilisierung, hatte die Syriza-Regierung keine Möglichkeit, sich der Troika zu widersetzen oder bei der europäischen Arbeiter*innenklasse um Unterstützung zu werben.
Jeremy Corbyns erster Rückzug war ebenfalls in der Frage der Europäischen Union (EU). Er gab seine frühere Opposition gegen den neoliberalen Club der 28 kapitalistischen Nationalstaaten im Referendum von 2016 auf, um drohende Rücktritte – durch die jetzigen Starmer-Vertreter Hilary Benn und Pat McFadden! – aus seinem ersten Schattenkabinett abzuwenden. Doch in seiner unmittelbaren Reaktion auf das Ergebnis des Referendums akzeptierte Corbyn das Ergebnis unmissverständlich und bezeichnete es in späteren Erklärungen richtigerweise als „ein Votum der Menschen im linken Großbritannien gegen ein politisches Establishment, das sie im Stich gelassen hat“. (The Guardian, 8. Juli 2016) Notwendig sei es, „eine neue Beziehung mit der EU auszuhandeln… die Arbeitsplätze, Lebensstandards und Arbeitnehmerrechte schützt… ein Ende der von der EU erzwungenen Liberalisierung und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen – und für Freiheit für öffentliche Unternehmen und öffentliche Investitionen, die jetzt durch EU-Verträge eingeschränkt werden“.
Bei den Parlamentswahlen 2017 verzeichnete Corbyn den größten Stimmenzuwachs für die Labour-Partei seit 1945, sowohl in absoluten Zahlen (3,53 Millionen zusätzliche Stimmen) als auch prozentual (plus 9,6 Prozent), einschließlich eines Wechsels von einer Million Wählern, die 2015 Nigel Farages UKIP unterstützt hatten. Aber das war nicht von Dauer. Anstatt den neoliberalen Charakter der EU-Verträge und -Institutionen scharf anzugreifen und zu erklären, dass eine von ihm geführte Regierung alle notwendigen sozialistischen Maßnahmen ergreifen würde, um die Interessen der Beschäftigten unabhängig von den geltenden EU-Regeln zu schützen – und festzuhalten, dass dies die Grundlage sein würde, auf der er verhandeln würde, was die gesamte Debatte verändert hätte -, tat er alles, was möglich war, um sich mit dem prokapitalistischen, EU-freundlichen rechten Flügel der parlamentarischen Labour Party zu arrangieren. Dazu gehörte, dass er Sir Keir Starmer als Schatten-Brexit-Minister beibehielt, obwohl Starmer versuchte, die Labour-Partei dazu zu verpflichten, das Ergebnis des Referendums von 2016 rückgängig zu machen. Corbyns Pro-Arbeiter*innenklasse- und Anti-Austeritäts-Botschaft wurde auf fatale Weise verwischt.
Die neue Ära birgt Gefahren für die Einheit der Arbeiter*innenbewegung, aber auch neue Möglichkeiten, die Kräfte für eine sozialistische und internationalistische Alternative zum Kapitalismus auf der ganzen Welt aufzubauen.