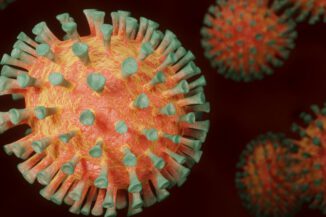Über die wirtschaftlichen und politischen Folgen der Krise für den Osten
Der Virus traf einige Tage später in Ostdeutschland ein und in zwei der sogenannten neuen Bundesländern sogar erst nach Wochen. Wenn man die Infektionszahlen aktuell ansieht, möchte man meinen, dass der Osten der Republik doch noch ganz gut durch die Krise kommen könnte.
von Alexandra Arnsburg, Berlin
Doch die wirtschaftlichen Auswirkungen stehen nicht im direkten Verhältnis zu den reinen Zahlen an neuen Infektionen. Bisher haben 87.000 Betriebe in Ostdeutschland Kurzarbeit angezeigt, das ist im Durchschnitt jeder sechste Betrieb, in Sachsen ist es sogar jeder vierte. In den westdeutschen Bundesländern, die der Virus am härtesten getroffen hat, wie Bayern und Baden-Württemberg, liegt diese Quote aktuell bei unter zehn Prozent.
Ostdeutsche Wirtschaft schon vor der Krise instabil
Einige Betriebe, wenn auch zum Teil sehr kleine, konnten ihre Produktion umstellen: von Schnaps oder Biokraftstoff auf Desinfektionsmittel und vom Nähen von Geschirrtüchern auf Mundschutzproduktion. Einige können ihre Umsatzzahlen aufgrund des höheren Bedarfs an bestimmten Produkten steigern, zum Beispiel ordnete der Nudelhersteller Riesa extra Schichten an. Mit seinen 145 Mitarbeitern zählt er in Sachsen schon als Großbetrieb. Nur drei Prozent der Betriebe in dem Bundesland haben mehr als 249 Beschäftigte, erklärte ein Vertreter des sächsischen Wirtschaftsministeriums im mdr-Interview bezüglich des Rettungsschirms für die sächsische Wirtschaft. Um den Mittelstand zu retten, haben die Landesregierungen zusätzlich zu den bundesweiten Hilfen noch einmal deutlich nachgelegt. Jedoch hält sich die Lust auf Kredite in der derzeitigen Lage bei vielen ostdeutschen Kleinunternehmer*innen in Grenzen, da unklar ist, ob diese je wieder zurückgezahlt werden können. Schon vor der Corona-Krise meldete das ifo-Institut einen massiven Einbruch in den Erwartungen in die eigene wirtschaftliche Entwicklung der Betriebe im Osten, obwohl das Wirtschaftswachstum im letzten Jahr sogar leicht höher ausfiel als im Westen, um 0,6 Prozent laut Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Durch die Krise wird die sehr kleinteilige Wirtschaftsstruktur, die hohe Abhängigkeit einzelner Regionen von der Landwirtschaft und vom Tourismus zu enormen Problemen führen. Einzelne Regionen wie Usedom sind komplett von den Portemonnaies der reisefreudigen Bevölkerung abhängig.
Ostdeutsche Beschäftigte schon vor der Krise ärmer
Doch auch die Menschen im Osten, die kein kleines Unternehmen führen, bekommen die Krise härter zu spüren als die meisten ihrer Kolleg*innen in den sogenannten alten Bundesländern. Sechzig Prozent bzw. 67 Prozent Kurzarbeitergeld bedeuten in Ostdeutschland, wo die Beschäftigten im Durchschnitt eine Stunde mehr für einhundert Euro weniger die Woche arbeiten, für einen wesentlich höheren Anteil, dass sie sofort staatliche Hilfen in Form von Wohngeld, Kinderzuschuss und Hartz IV beantragen müssen. So leisteten in Ostdeutschland Arbeiter*innen zuletzt über alle Wirtschaftsbereiche hinweg pro Jahr 63 Arbeitsstunden mehr als ihre Kolleg*innen in Westdeutschland. In Ostdeutschland kamen demnach im Jahr 2018 1390 Arbeitsstunden auf einen Beschäftigten – in Westdeutschland 1327.
Die Bruttomonatsverdienste im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich sind in Ostdeutschland mit durchschnittlich 2833 Euro immer noch deutlich niedriger als in Westdeutschland. Hier sind es 3371 Euro. Diese Zahl stammt von Ende 2019 und zeigt die Lage bei Vollzeit-, Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten. Im verarbeitenden Gewerbe ist der Unterschied mit 3073 Euro im Osten und 4322 Euro im Westen noch größer.
Dazu kommt, dass im Osten viel weniger Betriebe tarifgebunden sind und so ein kleinerer Teil von Beschäftigten in den Genuss von Zuschlägen zum Kurzarbeitergeld durch die Unternehmen von bis auf achtzig oder 85 Prozent kommt. Lediglich 45 Prozent der Betriebe haben hier eine Tarifbindung im Vergleich zu 56 Prozent im Westen. Auch wenn die meisten Städte und Landesregierungen weitere Maßnahmen ergriffen haben und zum Beispiel Mietkündigungen bis Ende September aussetzen, ist vielen nicht klar, wie sie bei dem geringen Einkommen und drohender Arbeitslosigkeit dieses Geld später aufbringen sollen. Schon jetzt ist jeder dritte (31 Prozent) verschuldete Ostdeutsche aufgrund von Mietzahlungen in dieser Situation, im Westen sind es 18 Prozent. Doch auch bundesweit sind zehn Prozent der privaten Haushalte bereits verschuldet und ein Drittel aller Haushalte haben gar keine Rücklagen und nach neueren Statistiken können vierzig Prozent keinen Euro im Monat beiseite legen.
Ostdeutsche Betriebe nach 1990 auf dem Ramschtisch
Für die massive Deindustrialisierung und Privatisierung der Ostwirtschaft durch die Treuhand ab 1990 müssen ostdeutsche Arbeit*innen bis heute die Zeche zahlen. 8000 Betriebe, zwanzig Milliarden Quadratmeter Agrarfläche, 25 Milliarden Quadratmeter Immobilien, Forsten und Seen, 40.000 Geschäfte und Gaststätten, 314 Betriebsambulatorien, 5.500 Gemeindeschwesternstationen, dazu Hotels, Ferienheime, Auslandsvermögen, Patente, Kulturgüter waren in Volkseigentum, wenn auch unter der stalinistischen Diktatur. Klaus Blessing, letzter DDR-Finanzminister, errechnet ein Volksvermögen von zwischen 1,2 und zwei Billionen D-Mark. Die Treuhand setzte es auf 600 Milliarden an und verscherbelte es zu 85 Prozent in den Besitz Westdeutscher, zu zehn Prozent ins Ausland, nur fünf Prozent blieben in ostdeutschem Besitz. Ganze Regionen wurden plattgemacht, Betriebe geschlossen, Bahnhöfe stillgelegt. Obwohl vor drei Jahren erstmals mehr Menschen nach Ostdeutschland, vor allem nach Berlin zogen, leben auf dem Gebiet der ehemaligen DDR immer noch 3,6 Millionen weniger Menschen als vor der kapitalistischen Restauration. 1991 hieß es, die Betriebe gehen pleite, wenn die Löhne von Ostmark 1:1 in Westmark ausgezahlt werden müssten und bekommt ein Tischler in Cottbus heute immer noch 16.000 Euro weniger im Jahr als sein Kollege in Stuttgart.
Ostdeutsche Landesregierungen greifen jetzt härter durch
So unterschiedlich die Voraussetzungen in den Bundesländern sind, so sind es auch die Maßnahmen der Landesregierungen, die die Ausbreitung des Virus stoppen sollen. Als in Bayern und Hessen noch Veranstaltungen bis einhundert Personen erlaubt waren, verbat der Freistaat Sachsen bereits Ausflüge auch einzelner aufs Land. Heute darf ein Sachse sich nur 15 km von seiner Wohnung entfernen, wogegen in Baden-Württemberg noch zu fünft gegrillt werden darf. Mecklenburg-Vorpommern, das mit zweihundert Infizierten auf eine Millionen Einwohner*innen am geringsten betroffene Bundesland, verbietet sogar Menschen mit Zweitwohnsitz diesen aufzusuchen und errichtete Straßenkontrollen. Zudem wird berichtet, dass die staatlichen Organe schneller und härter durchgreifen und höhere Bußgelder verhängen, obwohl die Landesregierung in Sachsen von weniger Verstößen als im Westen berichtet. Provisorisch wurden dort auch schon mal einige Zimmer in psychiatrischen Kliniken freigeräumt, um dort sogenannte „Quarantäne-Verweigerer“ wegzusperren. In Ostdeutschland kommt es auch zu mehr Anzeigen durch „besorgte Bürger“ bis hin zu Steinwürfen auf Autos mit fremden Kennzeichen auf Usedom. In der Region gibt es für die 8500 Menschen, die dort ohne Tourist*innen leben, nicht mal ein Krankenhaus, sondern lediglich ein paar Allgemeinärzte. Das war auch ohne das Virus schon ein Problem.
Ostdeutsche AfD bleibt stabil in den Umfragen
Rassistische Vorurteile werden im ganzen Land geschürt. Der SWR recherchierte zwei Wochen in sozialen Medien und spricht sogar von einer „Hass- und Rassimus-Pandemie“ besonders durch AfD-Politiker*innen und das Umfeld der entsprechenden Seiten.
Die AfD-Umfragewerte liegen zwar bundesweit nur noch bei neun bis zehn Prozent, im Osten bleibt sie aber stabil: In Thüringen liegt sie konstant bei 23 Prozent (-0,4); in Mecklenburg-Vorpommern bei -1 Prozent (bei 19 Prozent gleich mit der SPD); in Brandenburg bei 20 Prozent (-3,5), in Berlin bei 11 Prozent (+3,2) und in Sachsen-Anhalt bei 25 Prozent (+0,7). Für Sachsen gibt es noch keine Zahlen, bei den letzten Umfragen im Januar lag sie bei 27,5 Prozent. Ein Anstieg auf 30 Prozent wäre aber möglich.
Die AfD zieht Kraft aus der Enttäuschung und speist sich aus der realen und der gefühlten Entfremdung. Diese begann mit der Treuhand und setzt sich bis heute mit der kapitalistischen Marktwirtschaft fort. Die AfD kann teilweise Lücken füllen, die durch massive Einsparungen im sozialen und anderen Bereichen entstanden sind und kann sich so in Jugendclubs, Kultureinrichtungen und sogar bei der freiwilligen Feuerwehr einnisten. In dreißig Jahren hat der Kapitalismus Ostdeutschland nicht auf das Lebensniveau des Westens heben können, was anfangs die meisten Ostdeutschen gehofft hatten. Inzwischen ist diese Hoffnung dahin und vor allem eine Wut auf „die da oben“ macht sich breit. Auch das kann die AfD für sich nutzen, da sie als einzige Anti-Establishment-Partei wahrgenommen wird. Das geschieht sogar auch wenn diese Partei offen auf der Seite der Unternehmer steht und zum Beispiel nicht für Mietschuldenstreichungen, sondern für die vermeintlichen Rechte privater Vermieter eintritt. Lieber schimpft die AfD auf fünfzig Kinder, die die Bundesregierung aus Moria evakuiert und macht diese schon im Vorfeld für eine weitere Verbreitung des Virus und verschärfte Einschränkungen, die ihre Wählerschaft treffen, verantwortlich und lenkt damit von den wirklichen Ursachen der (Corona-)Krise ab.
Ostdeutsche LINKE ist keine Oppositionspartei
Dass die Partei DIE LINKE in einigen ostdeutschen Bundesländern in der Regierungsverantwortung dennoch ihre Umfragewerte leicht verbessern kann, liegt vor allem daran, dass bei einem Teil der Bevölkerung die „Wir sitzen in einem Boot“-Aussage Anklang findet und es breite Unterstützung für die Maßnahmen gibt, die die Verbreitung des Corona-Virus stoppen soll. So legt sie in Thüringen sechs Prozent zu und stärkt damit die rot-rot-grüne Regierung, in Mecklenburg Vorpommern sind es zwei und in Sachsen-Anhalt knapp zwei Prozent. Für Sachsen gibt es derzeit keine Zahlen. Doch wenn der Boden für Rassismus und rechten Terror durch die Krise nun noch mehr genährt wird, dann ist es nicht die Aufgabe der LINKEN einfach alles abzunicken, ein paar kleinere Anpassungen vorzunehmen und ansonsten mitzutragen, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich gerade durch scheinheilige Solidaritätsaufrufe der bürgerlichen Politik verwischt werden. In der Partei ist dringend ein Kurswechsel nötig, weg von staatstragender Politik und Regierungsbeteiligung hin zur Organisierung von Protest gegen mangelnde Versorgung mit Schutzkleidung, für die Umstellung der Produktion auf medizinisch notwendige Güter und gegen jede Maßnahme, die unsere Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen verschlechtert und unsere Grundrechte angreift, so wie es gerade mit der Aushebelung von Arbeitszeiten und Mitbestimmungsrechten geschieht. Sie muss offensiv die Verstaatlichung von Unternehmen und die Rekommunalisierung von Krankenhäusern fordern und dort wo sie in der Verantwortung ist, diese umsetzen. In einer Situation, wo immer mehr Menschen spüren, was das jahrzehntelange Profitdiktat in allen lebenswichtigen Bereichen für massive Auswirkungen hat und immer mehr Menschen klar wird, dass dieses System, der Kapitalismus, über Leichen geht, wäre es die Aufgabe einer sozialistischen Partei, genau das zu benennen, ein antikapitalistisches Notprogramm aufzustellen und zu erklären, dass eine sozialistischer Veränderung nun noch drängender und notwendiger denn je ist.
Nach der Krise ist vor der Krise – nicht nur im Osten
Es ist fraglich, ob es zu schaffen ist, das „Rückgrat Mittelstand“ sowohl im Osten als auch im Westen mit Krediten und Finanzspritzen zu retten und davon wird vieles, wenn nicht im Osten sogar alles, abhängen. Ewig werden Solidaritätsappelle und Spendenaufrufe für lokale Unternehmen nicht darüber hinwegtäuschen können, wo die Wurzel allen Übels liegt und dass erstens unser Boot keine Yacht mit Rettungsinseln wie das der Unternehmer ist und dass in dem Holz des Bootes, in dem die ostdeutsche Arbeiter*innenklasse sitzt, schon seit dreißig Jahren der Holzwurm nagt.
Es gibt Wut bei den Beschäftigten angesichts von dreißig Prozent Lohnunterschied in der Ernährungswirtschaft, die sich kurz vor Ausbruch des Virus gerade Bahn brach und Streiks und eine Großdemonstration auf die Tagesordnung setzte und bei den Ostmetaller*innen, die immer noch für die Reduzierung ihrer Arbeitszeit um drei Stunden auf Westniveau kämpfen, bei den Beschäftigten in der Pflege, wo viele ein jahrzehntelanges Spardiktat nun mit ihrer Gesundheit oder gar mit ihrem Leben bezahlen und bei Zugezogenen und Jugendlichen, die zum Spielball von Polizeiwillkür werden. Diese Wut kann sich, angesichts der zu erwartenden harten Folgen der Krise, in spontanem Protest und Widerstand ausdrücken, wie es nach der Einführung der Agenda 2010 bei den wöchentlichen Montagsdemonstrationen im Osten der Fall war. Es gibt aber auch die Gefahr, dass AfD & Co. Nutznießer davon sein werden. Ob dies geschieht wird nicht zuletzt davon abhängen, ob es gelingt für einen Kurswechsel in der Partei DIE LINKE und in den Gewerkschaften genügend Kräfte zu sammeln und eine kämpferische sozialistische Stimme aufzubauen. Eine Partei, die dafür eintritt, und so steht es im Programm gegen die Krise der SOL, dass der kapitalistische Konkurrenzkampf durch demokratische Planung ersetzt wird. Nur wenn statt einiger weniger Privateigentümer*innen und Großaktionär*innen, die arbeitende Bevölkerung selbst über Produktion, Forschung etc. entscheiden kann, werden diese Gefahren für die Menschen eliminiert werden können. Deshalb muss der Kampf gegen die Corona-Krise mit dem Kampf gegen den Kapitalismus und für eine sozialistische Demokratie verbunden werden.