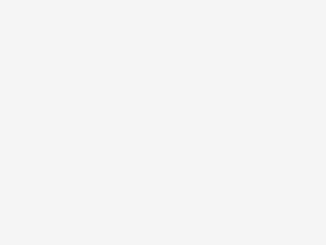Lauterbachs Nebelkerzen
Mit der Stellungnahme der Regierungskommission für die Krankenhausreform verhält es sich ähnlich wie mit dem neuen Bürgergeld. Erst werden große Ankündigungen gemacht, und am Ende gibt es einen neuen Namen, aber nichts wird besser. Der vorliegende Entwurf wurde Anfang Januar mit den Gesundheitsministerien der Länder beraten und soll die Grundlage für eine Gesetzesvorlage im Sommer bilden.
Von Anne Pötzsch, Medizinstudentin und Intensivpflegekraft, aktiv in ver.di und im Bündnis für Pflege Dresden, Streikaktive in der Berliner Krankenhausbewegung
Anders als öffentlich dargestellt, sollen die Fallpauschalen (DRGs) bleiben und es könnten noch mehr Kliniken schließen müssen. Lauterbach prahlte vor der Veröffentlichung mit einer „Revolution“ des Krankenhauswesens. Während aber eine Revolution einen grundlegenden, nachhaltigen Wandel eines Systems mit sich bringt, würde die Umsetzung der geplanten Krankenhausreform nur eine Verfestigung der Ökonomisierung des Gesundheitswesens bedeuten und die Missstände wahrscheinlich noch verschlimmern.
Was ist geplant?
Der vorliegende Entwurf würde bei einer Umsetzung sehr große Veränderungen für die Krankenhäuser nach sich ziehen. Als erstes sollen alle Krankenhäuser in so genannte Versorgungslevel eingeteilt werden. Je höher das Level ist, umso mehr kann ein Krankenhaus anbieten und umso höher ist die Ausdifferenzierung der möglichen Behandlungen.
Für die Einteilung in die Level soll es genaue Vorgaben für Struktur (personelle, räumliche und technische Ausstattung) und Qualität geben. Es soll Level I bis III geben, in denen es jeweils nochmal zu einer Unterteilung kommen kann.
Level I: Integrierte ambulant/stationäre Grundversorgung für die regionale Grundversorgung
Das erste Level ist in zwei unterteilt. Bei Level Ii soll es vor allem zu einer so genannten Ambulantisierung des Angebotes kommen. Der Schwerpunkt soll hier auf allgemeinen und spezialisierten ambulanten fachärztlichen Praxen liegen. Es kommt zu einer Auslagerung des stationären Angebotes. Somit sollen Krankenhausaufnahmen reduziert werden und Patient*innen ambulant behandelt und nachmittags wieder nach Hause geschickt werden. Zusätzlich sollen einige wenige Akutpflegebetten für eine Überwachung oder eine Basistherapie angeboten werden. Diese Betten sollen nur von Pflegekräften betreut werden, somit gibt es vor allem nachts kein ärztliches Personal. Man kann sich dies in etwa wie einen kurzen Aufenthalt in einem Pflegeheim vorstellen. Diese Level Ii – Einrichtungen können von speziell geschulten Pflegekräften geleitet werden.
Dem Level In soll ein so genannter Sicherstellungsauftrag mit stationärer internistischer und chirurgischer Basisversorgung zugewiesen werden. Zudem ist für dieses Level eine Basisnotfallversorgung vorgesehen. Somit haben diese Krankenhäuser ein stationäres Angebot, können jedoch nur einfache medizinische Angebote leisten, wie beispielsweise eine Blinddarmentfernung, eine Geburt bei normalem Schwangerschaftsverlauf oder die stationäre Betreuung einer leichten Lungenentzündung. Eine intensivmedizinische Behandlung wie eine Beatmung kann nur kurzfristig gewährleistet werden und führt immer zu einer Verlegung der Patient*innen in ein Krankenhaus des Levels II oder III.
Level II: Grund + Regel + Schwerpunkt-Versorgung
In Level II-Krankenhäusern würde die vollstationäre Grund- und Regelversorgung stattfinden. Hier können wesentlich mehr Operationen angeboten werden, wie das Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenkes. Auch die Kinderchirurgie ist hier möglich und eine umfassende Notfallversorgung in einer Rettungsstelle. Zudem soll es spezielle Versorgungangebote vor allem in Fachkliniken geben, die zwar keine Notfallversorgung vornehmen, aber für eine Region elementar sind und so in Level II–Krankenhäuser mit eingegliedert werden können.
Level III: Maximalversorgung
Level III-Krankenhäuser dienen der Maximalversorgung. Einfach gesagt, sind dies Krankenhäuser, die auch schwerste Krankheitsbilder versorgen und spezielle Therapien anbieten können. Hier können beispielsweise Organe transplantiert oder schwere Hirnblutungen operiert werden. Zudem wird es in diesem Level noch einmal speziell das Level IIIu geben: Die Universitätskliniken sollen demnach zusätzlich die Koordinierung aller Krankenhäuser in einer Region vornehmen und die anderen Krankenhäuser durch die höhere Expertise unterstützen.
Neben der Einteilung in Level stellt sich die Regierungskommission vor, das Leistungsangebot in rund 130 Leistungsgruppen zu unterteilen, die von einem Medizinischen Dienst (MD) kontrolliert werden sollen (hierbei ist MD nicht genauer spezifiziert). Wie bei der Leveleinteilung gäbe es für eine Leistungsgruppe genaue Vorgaben, was eine Klinik vorhalten und an Fallzahlen leisten müsse, um eine Leistungsgruppe zu erfüllen. Die Leistungsgruppen, welche in einer Klinik angeboten werden, sind zudem die Basis der Einteilung in die Level: je mehr Leistungsgruppen angeboten werden könnten, umso höher wäre demnach das Level einer Klinik.
Zukünftig soll die Vergütung weiterhin anteilig über die Fallpauschalen (DRGs) und über ein neues Vorhaltebudget erfolgen. Das Vorhaltebudget soll Kliniken dafür entlohnen, dass sie Krankenhausbetten vorhalten und die Möglichkeit bieten, Patient*innen aufzunehmen. Dieses ersetze vierzig Prozent der aktuellen DRGs, beziehungsweise sechzig Prozent in der Intensiv- und Notfallmedizin sowie bei der Geburtshilfe und Neonatologie (Intensivmedizin bei Frühgeborenen). Dieses Budget soll jedoch an die Erfüllung der Struktur- und Qualitätsvorgaben der Leistungsgruppen durch die Kliniken gebunden sein. Der ökonomische Druck soll laut der Regierungskommission nicht erlöschen, da die Kommission sonst nicht den Anreiz für eine qualitative Arbeit sieht. So heißt es im Entwurf: „In der Theorie sollte der Abschlag unterhalb der Fixkosten liegen, um einen Leistungsanreiz für Krankenhäuser zu erhalten.“ Zudem fordert die Regierungskommission eine Bedarfsplanung auf Länderebene, um zu ermitteln, was die Bevölkerung einzelner Regionen benötigt. Danach soll die Krankenhauslandschaft geplant und strukturiert werden. Erreicht werden soll die neue Krankenhauslandschaft und die neue Form der Vergütung der Kliniken in gerade mal fünf Jahren.
Was würde die Reform bedeuten?
Seit nun zwanzig Jahren klagen Gewerkschaften, Pflegebündnisse und die Beschäftigten in den Kliniken das Fallpauschalensystem an. Durch die Ökonomisierung des Krankenhausbetriebes haben sich die Zustände massiv verschlechtert, weil viele Pauschalzahlungen die tatsächlichen Kosten nicht decken, die Kliniken unter großen Kostendruck geraten und unter anderem an Personal sparen müssen. Immer mehr Pflegekräfte und Therapeut*innen kehren ihrem Beruf in der Klinik den Rücken, weil sie unter den schlechten Arbeitsbedingungen nicht mehr arbeiten können und teilweise sogar erkrankt sind.
Die geplante Reform der Krankenhausvergütung würde jedoch die Bedingungen verschärfen, statt sie zu verbessern. Das Gesamtbudget für die Kliniken soll nicht steigen, wie die Regierungskommission sehr deutlich in ihrer Stellungnahme betont. Seit Jahren klagen aber die Krankenhäuser darüber, dass sie nicht kostendeckend entlohnt werden und so Personalkosten einsparen müssen oder Gelder aus anderen Budgets (zum Beispiel zum Erhalt des Gebäudes) herausnehmen müssen. Vor allem kleine und kommunale Kliniken schreiben seit Jahren rote Zahlen, wodurch das Krankenhausbudget eigentlich steigen müsste, um die Kosten des Betriebes zu decken. Auch wäre es von essentieller Bedeutung, wenn die Länder ihren Investitionskosten in voller Höhe nachkommen würden – momentan schulden die Länder den Kliniken viele Milliarden Euro für Erhalt und Ausbau der Infrastruktur.
Durch das Vorhaltebudget würde sich der ökonomische Druck in den Kliniken nochmal erhöhen. Das Vorhaltebudget ist neben Qualitätsmerkmalen auch an die Erbringung bestimmter Fallzahlen gebunden. Das kann man sich so vorstellen: Eine Klinik, die zurzeit im Jahr 150 künstliche Hüftgelenke einbaut, müsste weitere hundert Hüftgelenke einbauen, um die geforderten Fallzahlen von 250 Hüftgelenk-Operationen zu erfüllen. Dann würde sie das volle Vorhaltebudget erhalten. Dafür bekäme dieses Krankenhaus vierzig Prozent der Gesamtkosten aus der Vorhaltevergütung. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Klinik nicht die vollen vierzig Prozent erhält, wenn die Klinik nur 220 künstliche Hüftgelenke einbaut. Auch verliert dann die Klinik auf Dauer den Zuschlag für die jeweilige Leistungsgruppe und erhält nicht mehr die Vorhaltvergütung für diese Leistungsgruppe. Die Klinik ist somit dazu gezwungen, die vorgegeben Fallzahlen zu erreichen oder zu übersteigen. Somit muss eine Klinik weiterhin unter ökonomischen Druck arbeiten, denn die Fallzahlen müssen erbracht werden, egal ob dafür ein reeller Bedarf vorhanden ist oder nicht.
Ökonomische Interessen
Mehrere Mitglieder der Regierungskommission sind Gesundheitsökonom*innen. Ihr Ziel ist eine weitere Liberalisierung des Gesundheitswesens, was man deutlich aus der Stellungnahme herauslesen kann. Sie lehnen ab, dass Kliniken die tatsächlichen Kosten erstattet bekommen. Sie wollen den Kostendruck auf die Kliniken erhöhen und begründen dies mit einer Qualitätssteigerung, die nur durch finanzielle Anreize gegeben sei. Doch der Großteil der Beschäftigten arbeitet jetzt schon ohne jeglichen finanziellen Anreiz – keine*r von ihnen bekommt angemessene Gehälter, Boni oder ähnliches, wenn sie jeden Tag gute, qualitativ hohe Arbeit leisten und sich selbst aufreiben. So klingeln die Kassen der Aktionär*innen und Anteilseigner*innen von privaten Häusern , wenn Kliniken Patient*innen wie in Fabriken durchschleusen. Die Argumentation der Qualitätssicherung und -steigerung ist eine ideologische Verschleierung wirtschaftlicher und materieller Interessen einzelner Kapitalist*innen im Gesundheitssystem. Gleichzeitig sollen damit Kosteneinsparungen in den noch öffentlichen Krankenhäusern gerechtfertigt werden. In Wirklichkeit bedeutet diese Reform also eine Fortsetzung der Politik, die dazu dient, dem Kapital Anlagemöglichkeiten zu bieten, Profite zu generieren und Kosten der öffentlichen Hand einzusparen. Dieses Prinzip läuft aber einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung zuwider.
Krankenhausschließungen
Der Kostendruck führt schon länger zur Schließung von Krankenhäusern. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) befürchtet bereits für das Jahr 2023 eine Insolvenzwelle deutscher Kliniken. Das Krankenhaussterben würde mit der Reform ab 2024 voranschreiten und die Welle der Krankenhausschließungen verstärken. Mehrere Mitglieder der Regierungskommission haben sich bereits in der Vergangenheit für weitere Krankenhausschließungen positioniert. Vor allem kleine Krankenhäuser würden die Vorgaben der Leistungsgruppen nicht erfüllen können, da sie geforderte Fallzahlen nicht vorweisen und auch Strukturvorgaben aufgrund fehlender Mittel nicht erbringen können. Denn die Zuschläge für die gut vergüteten Leistungsgruppen und damit die Einstufung in Level II oder III würden vor allem große und private Kliniken erbringen können. Kleine Häuser würden dann vermutlich oft in Level I rutschen und den stationären Betrieb schließen müssen. Dies würde vor allem in ländlichen Gegenden die Bevölkerung hart treffen und ist deshalb mit aller Kraft zu bekämpfen.
Ambulanter Bereich
Mit dem Level I strebt die Regierungskommission und auch Karl Lauterbach eine massive Ambulantisierung an. Als Grund dafür nennen sie auch das fehlende Fachpersonal, welches einen stationären Betrieb aufrechterhalten könnte. Anstatt sich um die Frage zu kümmern, wie man zukünftig Personal halten, Berufflucht verhindern und Nachwuchsmangel beheben möchte, sucht man nach Lösungen, um den Personalmangel auf dem Rücken der Patient*innen auszutragen. Durch die Ambulantisierung möchte man unter anderem den Nachtdienst abbauen, um Personal zu sparen, da Patient*innen nun nicht mehr nachts überwacht werden sollen.
Es ist vollkommen richtig, dass der ambulante Bereich ausgebaut und gefördert werden muss. Der ambulante Bereich wurde wie die Kliniken kaputtgespart und für das Fachpersonal meist unattraktiv, wenn nicht sogar prekär. Wir brauchen dringend wohnortnahe und gut ausgebaute ambulante medizinische, therapeutische und pflegerische Angebote, welche für alle zugänglich sind. Einerseits, um das erhöhte Patient*innenaufkommen des demografischen Wandels abzufangen, andererseits um auch Prävention und gute Betreuung von chronischen Krankheiten zu gewährleisten. Jedoch sollte und kann dies nicht durch die Schließung von stationären Einheiten passieren.
Über- und Unterversorgung
Es ist ein Ammenmärchen, dass das Hauptproblem in den Kliniken eine Überversorgung sei. Durchaus finden zwar ungerechtfertigte Eingriffe statt, um hohe Vergütungen aus den DRGs zu ziehen – das würde sich mit dem neuen System auch nicht ändern. Doch werden oft viele benötigte Behandlungen gar nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt, da ihre Fallpauschalen die Kosten nicht decken. Durch die Ambulantisierung sollen Eingriffe und Behandlungen, die heute noch – medizinisch völlig gerechtgertigt – mit einer stationären Versorgung verbunden sind, ausgegliedert werden. Dadurch würde für die Patient*innen eine Überwachung verloren gehen. Postoperative Komplikationen können durch die Patient*innen daheim nicht selbst erkannt werden, wodurch entweder gar nicht oder nur verspätet reagiert werden könnte.
Angehörigen-Pflege
Im vorliegenden Entwurf schlägt die Regierungskommission den Einbezug der Angehörigenpflege in Level Ii vor. Bei der Angehörigenpflege lädt der Staat seine Fürsorgepflicht auf die Familien ab. Angehörigenpflege bei dauerhafter Pflegebedürftigkeit wird meistens durch Frauen durchgeführt. Sie findet oft neben der Lohnarbeit der Pflegenden statt, welche oft nur in Teilzeit ausgeführt werden kann. Dadurch geraten die Familien in finanzielle Nöte, sowohl akut als auch zukünftig, da weniger in die Rentenkasse eingezahlt werden kann. Auch ist die psychische Belastung der pflegenden Angehörigen hoch und führt nicht selten in ein Burnout. Es ist die Aufgabe des Staates, genügend professionelle Pflege zu stellen, damit Pflegebedürftige in ihrer eigenen Häuslichkeit oder in Heimen ausreichend versorgt werden.
Es liegt nicht in der Verantwortung der Familien, die Angehörigen pflegerisch zu versorgen – schon gar nicht im Kontext eines Klinikaufenthaltes. Eine Familie sollte, wenn überhaupt vorhanden, für die seelische Fürsorge bei Krankheit da sein. Pflege – sowohl bei akuter Krankheit als auch bei dauerhafter Pflegebedürftigkeit – gehört in die Hand von Pflegefachpersonal. Auch stellt sich die Frage, wie sich die Regierungskommission die Angehörigenpflege bei akuter Krankheit vorstellt, wenn die Angehörigen der Erkrankten einer Lohnarbeit nachgehen, Kinder zu versorgen haben oder selbst gesundheitlich eingeschränkt sind.
Was bräuchte das Gesundheitswesen eigentlich?
Oft wird so getan, als ob die Zustände im Gesundheitswesen, wie zum Beispiel der Fachkräftemangel, unerwartete Naturphänomene wären. Dass das DRG-System nicht funktioniert, musste das Gesundheitsministerium immerhin anerkennen. Neue komplizierte Finanzierungskonzepte wurden nun ausgearbeitet, die angeblich die Mechanismen verbessern sollen. Dabei ist es relativ einfach: Solange Profitlogik herrscht, wird es keine Besserung geben. Stattdessen müssten Profitmöglichkeiten und Privateigentum vollständig aus dem Gesundheitswesen verschwinden. Mit Krankheit, Alter und Pflegebedürftigkeit dürfen keine Profite mehr gemacht werden!
Enteignung und Rekommunalisierung
Alle privaten Konzerne wie Asklepios, Helios und Sana müssen in öffentliches Eigentum überführt werden. Ehemals städtische Krankenhäuser gehören rekommunalisiert und sollten unter der demokratischen Kontrolle und Verwaltung von Beschäftigten, Gewerkschaften, Kommune und Patient*innenvertretungen geführt werden. Auch alle ausgegliederten Servicegesellschaften müssen wieder in öffentliche Häuser überführt werden.
Die Pharmakonzerne und die Medizingerätehersteller generieren Milliardenprofite, die sowohl von den Krankenkassenbeiträgen als auch von Patient*innen privat bezahlt werden müssen. Auch sie gehören in öffentliche Hand. Unter demokratischer Kontrolle und Verwaltung durch die arbeitende Bevölkerung könnte auch erreicht werden, dass Medikamente und Impfstoffe nach Bedarf produziert werden. Eine enorme Verschwendung durch Vermarktung und Werbung für verschiedene Marken von ein und denselben Wirkstoffen auf der einen Seite und ein Mangel an wichtigen Medikamenten auf der anderen Seite könnte durch eine bedarfsgerechte Planung und Produktion beseitigt werden werden. Die gesamte Erforschung von Wirkstoffen könnte außerdem außerhalb von privaten Patenten und Profitinteressen erfolgen.
Finanzierung
Das DRG-System gehört endlich vollständig abgeschafft. Die Krankenhäuser müssen durch staatliche Gelder vollständig finanziert werden. Die gesetzlichen und privaten Krankenkassen müssen zusammengeführt werden. Ziel sollte ein steuerfinanziertes öffentliches Gesundheitswesen, sein welches für jeden Menschen frei zugänglich ist.
Der Staat muss in Milliardenhöhe ins Gesundheitswesen investieren – anstatt in Rüstung. Diese Investitionen können durch die Profite enteigneter Gesundheits- und Pharmakonzerne, einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer und einer höheren Besteuerung von Unternehmensgewinnen ermöglicht werden. Ohne Kostendruck und mit demokratischer Planung kann sich in kürzester Zeit die Lage im Gesundheitswesen erheblich entspannen.
Mehr Personal
Im Gesundheitswesen müssen sofort in allen Bereichen mehr Stellen finanziert werden – von der Reinigungskraft bis zur Pflegekraft, von Rettungssanitäter*innen bis zu Therapeut*innen und viele mehr Es braucht zudem sofort eine Ausbildungsoffensive aller medizinischen Berufe. Die Ausbildungen müssen durch den Bund und die Länder finanziert werden. Für die praktische Ausbildung braucht es Raum und Zeit. Auszubildende dürfen nicht auf sich allein gestellt sein. Berufe wie in der Pflege können nur attraktiver werden, wenn sich die Arbeitsbedingungen inklusive der Ausbildungsvergütungen verbessern, die Gesunderhaltung der Arbeiter*innen gewährleistet ist und der Beruf mit einem Leben außerhalb der Klinik zu vereinbaren ist.
Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung hat aufgezeigt, dass 300.000 zusätzliche Vollzeitstellen in der Pflege durch Wiedereinstieg in den Beruf oder durch Aufstockung der Arbeitszeit besetzt werden könnten, wenn sich die Arbeitsbedingungen verbessern und Entlastung geschaffen werden würde.
Es braucht für alle Einrichtungen im Gesundheitswesen eine verbindliche Personalbemessung, die an dem reellen Bedarf orientiert ist und von den Beschäftigten definiert worden sind. Es bedarf mindestens 500 Euro mehr Entlohnung für alle Pflege- und Funktionsberufe, deutliche Reduzierung der Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich statt Teilzeitflucht. Auf diese Weise können Stellen besetzt und neue geschaffen werden – von der Pflege bis zu den Funktionsbereichen. Bundesweit müssen außerdem jährlich mehrere tausend zusätzliche Medizinstudienplätze finanziert werden, um den Ausbau des ambulanten Bereichs zu ermöglichen, wie der Marburger Bund seit Jahren anmerkt.
Bedarfsgerechte Versorgung
Es braucht flächendeckende ambulante Gesundheitszentren wie auch kommunale Krankenhäuser für die schnelle Notfall- und nötige stationäre Versorgung in Stadt und Land. In diesen Gesundheitszentren und Krankenhäusern muss es dem medizinischen Personal ermöglicht werden, die Patient*innen vollumfassend und kontinuierlich zu betreuen. Sowohl Prävention ab der Geburt bis ins hohe Alter muss finanziert sein als auch die Begleitung chronischer Erkrankungen.
Das gesamte Gesundheitswesen muss bundesweit und regional durch gewählte Gremien aus Beschäftigten, Gewerkschaften, Patient*innenverbände und Kommunen demokratisch kontrolliert und verwaltet werden. Die Verwaltungs- und Kontrollinstanzen müssen durch Mediziner*innen und Wissenschaftler*innen beraten werden, die nicht in Abhängigkeit irgendwelcher Konzerne, sondern im Dienst des staatlichen öffentlichen Gesundheitswesens stehen.
Zukunft – ein öffentliches Gesundheitswesen
Ein Gesundheitswesen, das die Menschen mit ihren Bedürfnissen im Blick hat, ist bezahlbar und umsetzbar. Allerdings wäre es Voraussetzung, dass keine ökonomischen Interessen im Mittelpunkt stehen. Wir brauchen ein öffentliches Gesundheitswesen nach Bedarf unter Kontrolle, Verwaltung und Planung von Beschäftigten, Gewerkschaften und Patient*innenverbänden. Dies wäre eine wahrhafte Revolution, die nur im Kampf gegen Kapitalinteressen erreicht werden kann.
Dafür braucht es kämpferische Gewerkschaften, die gemeinsam mit Pflegebündnissen und sozialen Bewegungen eine bundesweite Kampagne organisieren. Die LINKE müsste sich darauf fokussieren, eine solche Bewegung in Opposition zu unterstützen, anstatt auf der Ebene von Länderregierungen oder Kommunen die Misere mitzuverwalten, wie in Berlin, Bremen, Dresden und anderswo. Angesichts der zu erwartenden Verschärfung durch weitere Schließungen von Krankenhäusern und weiterem Personalmangel ist es nötiger denn je, dass ver.di eine Aktivenkonferenz einberuft, um zu diskutieren, wie man gemeinsam reagieren und kämpfen kann. Es gibt eine Vielzahl von guten lokalen Ansätzen wie Tarifkämpfe für Entlastung oder lokale Bewegungen gegen Privatisierung oder Schließungen – wir müssen sie zusammenbringen. Auch muss die anstehende Tarifrunde genutzt werden, um diese Themen auf Versammlungen zu diskutieren und in die gesamte Arbeiter*innenklasse zu tragen.
Jegliche Lobbyarbeit in Gremien und an Tischen von Regierenden ist zu beenden. Hier kann seit Jahrzehnten nichts gewonnen werden. Der Kampf für eine bedarfsgerechtes, menschenwürdiges und öffentliches Gesundheitswesen gehört auf die Straße.