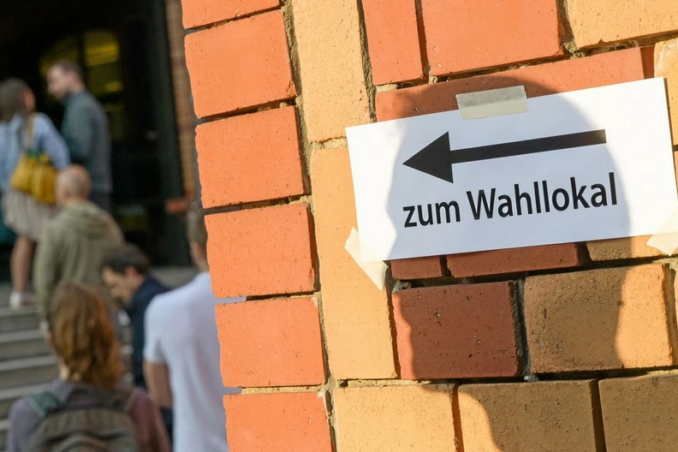
Krise des politischen Establishments auf kommunaler Ebene
Am 14. September fanden die Kommunalwahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland statt. Die Ergebnisse zeigen den Vertrauensverlust in die etablierten Parteien. Insbesondere die AfD konnte profitieren.
Von Jens Jaschik, Dortmund
Über ein Jahrzehnt „schwarze Null“, mangelnde Investitionen und Stillstand haben in Nordrhein-Westfalen zu immer weiter wachsendem Unmut geführt. Auf kommunaler Ebene merkt jeder und jede selbst, dass die Politiker*innen nichts an der sozialen Misere ändern. Die Parteien haben keine stabile finanzielle Basis, auf der sie die Kommunen regieren können und wissen selber nicht, wie weiter.
Dieses Jahr kommt es zu einer Rekordzahl an Stichwahlen um die Bürgermeister*innenämter. Nur in zwei Städten erreichten die Kandidierenden im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit. 2015 waren es noch sieben. 146 politische Posten müssen in einer zweite Wahlrunde entschieden werden. So viele wie noch nie.
Trotz eines leichten Zuwachses der Wahlbeteiligung blieben die Nichtwähler*innen die größte Partei. Nur 56 Prozent der Wähler*innen gingen zur Wahl. Gleichzeitig durften 1,8 Millionen Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in NRW haben, nicht an den Wahlen teilnehmen, weil sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Dies entspricht zehn Prozent der Bevölkerung des Bundeslands.
Die CDU wird in den Medien als die Wahlsiegerin präsentiert, weil sie ihr landesweites Durchschnittsergebnis halten konnte. Die SPD erzielte landesweit nur 22,1 Prozent der Wählerstimmen und somit das schlechteste Ergebnis seit 1946. Besonders im Ruhrgebiet, der ehemaligen Herzkammer der Sozialdemokratie, kommt es zu ernsthaftem Kammerflimmern. In Dortmund bekam die SPD bei der Oberbürgermeister*innenwahl nur 27,4 Prozent. Ein Rückgang von 8,4 Prozentpunkten im Vergleich zu 2020. Und schon damals konnte sich die SPD in der Stichwahl nur knapp mit zwei Prozentpunkten Vorsprung gegen die CDU durchsetzen. Dieses Jahr könnte die SPD ihre ehemalige Hochburg verlieren.
Aber auch das landesweite Ergebnis der CDU ist nur relativ gut. Zwar mussten sie mit einem landesweiten Ergebnis von 33 Prozent nur einen Prozentpunkt Verlust hinnehmen, trotzdem ist sie weit davon entfernt stabil regieren zu können. Schließlich gibt es in keinem Stadtrat eine deutliche Mehrheit für eine Partei. In der Zukunft stellt sich die Frage, ab wann die CDU auf kommunaler Ebene mit der AfD zusammenarbeiten wird, wie sie es schon in vielen Kommunen in Ostdeutschland macht.
Aufstieg der AfD
Wahlsieger ist klar und deutlich die AfD, die ihr Ergebnis verdreifachen konnte. In fast allen Städten ist sie die drittstärkste Kraft geworden. Der rasante Aufstieg der AfD verschärft die Probleme der etablierten Parteien.
In drei der ärmsten Städte Nordrhein-Westfalens ist die AfD sogar in der Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters – in Duisburg, Gelsenkirchen und Hagen. Zwar ist es sehr unwahrscheinlich, dass die AfD die Stichwahlen gewinnen wird, aber sie wird auf diesen Achtungserfolgen aufbauen können und mit ihren Sitzen in den Stadträten versuchen, die Politik dieser Städte zu beeinflussen. Die starken Wahlergebnisse der AfD werden die Partei zweifellos dazu ermutigen, sich weiter zu verankern. Bisher hat es die AfD nicht geschafft, in NRW auf den Straßen zu mobilisieren. Das kann sich jetzt ändern. Darauf müssen wir vorbereitet sein.
Um die AfD zu bekämpfen, müssen wir verstehen, warum sie so stark geworden ist. Die AfD profitiert nicht nur von ihrer bundesweiten Stärke. Ein Hauptgrund für ihren Wahlsieg ist, dass viele ihrer Wähler*innen den etablierten Parteien – insbesondere der SPD – eins auswischen wollten. Insbesondere in ehemaligen Industriestädten mit hoher Arbeitslosigkeit konnte die AfD hohe Gewinnen erzielen. Somit ist ihr Wahlerfolg zu einem erheblichen Teil eine Protestwahl. Doch jede Protestwahl liefert die Gefahr, dass die AfD ihre rassistische Hetze weiter verbreiten und verankern kann.
Verpasste Chance für Die LINKE
Die Linke hat ihr Potenzial bei der Kommunalwahl nicht ausgeschöpft. Zwar konnte sie in manchen Städten bzw. Stadtteilen Achtungserfolge erzielen, wie zum Beispiel in Köln-Kalk oder der Dortmunder Nordstadt, blieb aber mit ihrem landesweiten Durchschnittsergebnis von 5,6 Prozent bei hinter ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl im Februar zurück. Obwohl so viele Mitglieder wie noch nie in die Partei eingetreten sind und den Wahlkampf unterstützt haben, zeigt das Ergebnis, dass die Verankerung weiterhin zu wünschen übrig lässt und das gute Abschneiden bei den Bundestagswahlen viel mit der politischen Dynamik der Wochen und Monate vor dem Wahltag zu tun hatte und nicht einfach fortgeschrieben werden kann. Aber es sind auch selbstverschuldete Schwächen, die für das enttäuschende Ergebnis verantwortlich sind.
Zu wenig konnte Die Linke im Kommunalwahlkampf die Frage beantworten, wofür sie in den Kommunalparlamenten eigentlich genau einsteht und wie sie ihre Ziele erreichen will. Wahlplakate wie “Geht Wählen, ihr Mäuse” oder “Auf die Barrikaden, ihr Mäuse”, wie sie in Dortmund aufgehängt wurden, leisten wenig dazu, Arbeiter*Innen für die Partei zu gewinnen, aber auch die anderen Wahlplakate boten keine klaren, kämpferischen Slogans. Gleichzeitig bot die Führung auf Landes- und Bundesebene zu wenig Führung für den Wahlkampf.
Parallel dazu hat Die Linke in verschiedenen Kommunalparlamenten mit SPD und Grünen. oder manchmal auch der CDU, in wechselnden Mehrheiten zusammengearbeitet und Haushalte – alles mit dem Argument, kleine Verbesserungen zu erreichen – verabschiedet. Außerdem arbeiten die Fraktionen meist sehr losgelöst von der Parteibasis. Es gab keine Plan, dass Die Linke diese Politik ändern will und mit einer unabhängigen und eigenständigen Klassenpolitik in die Kommunalparlamenten einziehen will.
Wie weiter?
Keine der etablierten Parteien wird die soziale Situation in NRW verbessern. Der Erfolg der der AfD wird nur dazu beitragen, dass die etablierten Parteien sich auf kommunaler Ebene mehr nach rechts bewegen, wie sie es schon in der Bundespolitik unter dem Druck der AfD und der Hoffnung Wähler*innenstimmen zurückzugewinnen getan haben. Schon jetzt ist die CDU in vielen Städten mit einem Law & Order-Programm angetreten. Mit der Krise des Kapitalismus und den bevorstehenden Betriebsschließungen wird sich die Situation noch verschlimmern.
Was wir brauchen, ist eine sozialistische Antwort. Kommunalpolitik findet nicht nur im Parlament statt. Gerade durch organisierten Widerstand von Betroffenen, Mieter*innen, Beschäftigten oder Migrant*innen kann außerparlamentarischer Druck erzeugt werden und Verbesserungen erkämpft werden. Die Linke sollte ihre Positionen in den Kommunen dafür nutzen, um gemeinsam mit den Betroffenen ihre Interessen zu artikulieren und Widerstand zu stärken. Es ist notwendig, dass wir in und außerhalb der Partei Druck dafür aufbauen.




